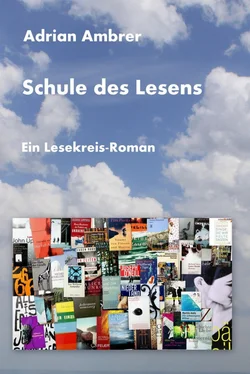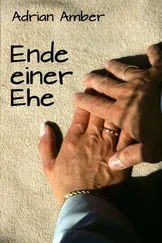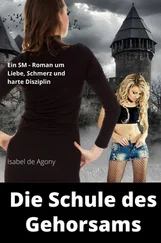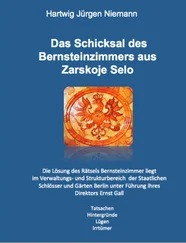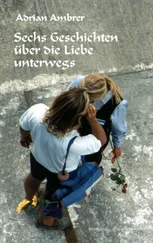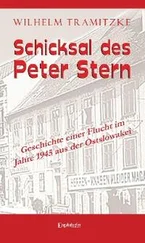Frank Rollter war ein jüngerer Kollege und Freund Lothar Klabs, ein sportlicher Mensch im Saft seines Lebens, umgänglich, neugierig und so ideenreich, dass die Studienreferendare in seinen Unterricht drängten, auch wenn sie ganz andere Fächer unterrichteten. Anders als Lothar war ihm Eitelkeit und Ehrgeiz wesensfremd, stattdessen war er auf eine entwaffnende Weise den Dingen selbst zugewandt. Wenn er mit seinen Leistungskursen „Don Carlos“ durchnahm, erschloss sich den Schülern der Charakter Philipps II weniger durch den Text, als durch die Ergriffenheit ihres Lehrers. Frank besaß eine kräftige Figur und einen schütteren Haarwuchs, was ihn in seinen besten Momenten einen attraktiven Marlon-Brando-Look verlieh. Niemals wäre Frank auf die Idee gekommen, er selbst könne als Autor etwas Nennenswertes schreiben – er betrachtete sich eher als einen literarischen Gourmet, der bei einer bescheidenen Einschätzung der eigenen Kochkunst entschlossen war, seine Geschmacksnerven in alle nur denkbaren Richtungen auszubilden. Während Lothar alles, was ihm in die Hände fiel, mit Neid im Herzen und der Frage las: „Warum habe ich das nicht geschrieben?“ suchte Frank in jedem Buch immer zuerst sich selbst. „Wer bin ich in diesem Buch?“ war die Frage, mit der er an jedes Werk heranging, und wenn er sich zu finden glaubte, dann gelang es ihm manchmal sogar, etwas Neues über sich zu erfahren.
Ähnlich wie Lothar befand sich auch Frank im Umbruch. Er war seit sieben Jahren mit Gisela, der Tochter seines ehemaligen Lateinlehrers verheiratet, einer Sandkastenliebe, von der er geglaubt hätte, sie würde ewig halten. Leider währte die Ewigkeit nur bis zu jenem Augenblick als er im Lehrerkollegium auf die zauberhafte Karin traf, eine junge Lehrerin für Geschichte und Latein, was ihn derart aus der Bahn warf, dass er zuerst fünf Kilo abnahm, aus der ehelichen Wohnung auszog und dann die Scheidung einreichte.
Die Literatur war voll von dergleichen Dramen, aber so sehr er auch die Texte seiner Lieblingsautoren Enzensberger, Celan und Joyce durchforschte: Nichts schien ihm auf seine Situation zu passen, in keiner der Figuren vermochte er sich wieder zu erkennen, was völlig neu für ihn war. Sogar in seinen englischsprachigen Lieblingsgedichten von Robert Frost fand er keinen Trost, was ihn noch mehr erstaunte. Am meisten aber litt er darunter, dass er seiner Frau, die ihn aufrichtig liebte, einen solchen Schmerz zufügen musste. „Der Liebende, der nicht mehr liebt, ist grausam, ohne es zu wollen“, las er bei einem deutsch-arabischen Autor. Dieser Gedanke trieb ihm die Tränen in die Augen und raubte ihm den Schlaf. Er war dabei, sich selbst abhanden zu kommen, und nachdem er monatelang darunter gelitten hatte, dass weder die frische Liebe zur zauberhaften Karin noch die alte Liebe zur tadellosen Gisela weichen wollte, nachdem weder das Kieser-Rückentraining, noch exzessives Mountainbiking geholfen hatte, entschloss er sich zur Gründung eines Literaturkreises. Vielleicht war nun die Zeit, im Gespräch mit ganz anderen Lesern ganz neue Bücher auf eine unbekannte Weise kennen zu lernen. Vielleicht war es möglich, aus der Literatur eine neue Richtung oder wenigstens ein wenig Abstand und Gelassenheit zu schöpfen.
Neben Lothar und Frank war Marcel Wolff der Dritte im Bunde. Marcel war ein Mensch, der von der Kunst und der Literatur lebte wie die Katze von der Milch. Er war ein regelmäßiger Gast von Lesungen und Vernissagen, fuhr zur documenta nach Kassel und hatte gleich zwei Literaturzeitschriften abonniert. Groß gewachsen, hager und blass besaß er mit seinen pechschwarzen Haaren etwas Asketisches, er war ein Stürmer und Dränger, der seine einmal gefassten Ansichten nur ungern revidierte und sie mit Temperament und Einsatz verteidigte.
Marcel hatte mit Frank zusammen studiert und ein ausgezeichnetes Staatsexamen in Deutsch und Mathematik abgelegt, ehe er als Studienrat zur Anstellung an eine Gesamtschule abgeordnet wurde. Marcel war es recht, denn er glaubte fest an den pädagogischen Mehrwert des Gesamtschulkonzeptes, musste aber bald feststellen, dass sich der schulische Alltag für einen Literaturfreund seines Kalibers bitter war. Marcel liebte verschachtelte Romankonstruktionen, die gar nicht kompliziert genug sein konnten, er genoss Anspielungen und Symbole und weigerte sich ein Buch zu schätzen, dass in seinem formalen Aufbau seinen Inhalt nicht mit reflektierte. Unnötig, zu erwähnen, dass bei seinen Schülern mit Texten von Kafka und Grass auf verlorenem Posten stand. Kafkas „Verwandlung“ konnte er seinen Schülern nur als eine Version von „Matrix Reloaded“ verkaufen, und längere Romane zu lesen kam schon deswegen nicht in Frage, weil kaum jemand auch nur drei Unterrichtsstunden in Folge anwesend war. Doch Dirks progressive Weltanschauung verbot ihm jede grundsätzliche Kritik am Gesamtschulkonzept. Es mussten halt Opfer gebracht werden, sagte er sich. Was zählten seine persönlichen Passionen, wenn es um eine gerechte Schule für alle ging? Nichts.
Verheiratet war Marcel mit Kerstin, einer freiberuflich tätigen Lektorin, die Massenbelletristik bis zur Veröffentlichungsreife bearbeitete. Erfüllt war Kerstin durch diesen Dienst an der Volksunterhaltung selbstverständlich nicht, so dass sie sich mit zwei gleich gesinnten Freundinnen in einem Debattierklub über feministische Postmoderne austobte, so oft es ihre Zeit erlaubte. Marcel, obwohl politisch korrekt bis zum Umfallen, durfte an diesem Debattierklub über die feministische Postmoderne als Mann selbstverständlich nicht teilnehmen.
Insgeheim war Marcel über diesen Ausschluss froh, denn er verfolgte bei seiner Lektüre ohnehin ein ganz anderes Interesse. Marcel elektrisierten an Büchern neben ihren formalen Raffinessen immer nur jene Elemente, die er als ganz persönlich an ihn selbst adressierte Gesprächsangebote auffassen konnte. Romane, die für ihn diesen Zauber einer intimen Zwiesprache zwischen Leser und Autor entfalten konnten, mochten sie modern oder traditionell, progressiv oder konservativ, obskur oder bieder sein – er blieb ihnen treu bis zur letzten Seite. Am liebsten war es ihm natürlich, wenn er einen Text wie einen verschlüsselten Brief lesen und zwischen den Zeilen nach verborgenen Mitteilungen des Autors forschen konnte. Marcel fragte nicht: „Warum betrügt Anna den Bernd?“ sondern immer nur: „Was hat sich der Autor dabei gedacht, dass er den Bernd durch die Anna an der Nase herumführen lässt?“ Oder noch zutreffender: „Was will mir der Autor persönlich damit sagen, dass er seine Geschichte so aufgebaut hat, dass genau an dieser und jener Stelle der Bernd der Anna zum Opfer fällt?“ Jedes Buch wurde ihm auf diese Weise zum Ursprung von tausend Nachfragen, die er anfänglich am liebsten an den Autor selbst gestellt hätte, bis er erkannte, dass es zum Wesen des Lesens gehört, zum Mitautor zu werden und somit auch in der Lage zu sein, sich seine Fragen selbst zu beantworten. Dafür war es allerdings erforderlich, dass sich im Zuge dieser imaginativen Recherchen eine Art Gesamtaussage ergab, deren Qualität sich danach bemaß, wie verschachtelt und kompliziert der Weg zu ihrer Enthüllung gewesen war. Keine Frage, dass Marcel sofort Feuer und Flamme war, als Frank ihn zur Teilnahme am Lesekreis einlud.
Das erste gemeinsame Treffen fand im Spätsommer statt, als Lothar, Frank und Marcel an einer Paul Auster Lesung im Kölner Schauspielhaus teilnahmen. Es war eine erstaunlich gut besuchte Veranstaltung, wenn man den enormen Eintrittspreis und den Umstand bedachte, dass der Meister zwar in all seiner Altersstattlichkeit erschienen war, seine Texte aber mit seiner wohl tönenden Stimme von Anfang bis Ende in Englisch vortrug. Der schlaksige, hoch gewachsene Autor präsentierte sich in einer zerknitterten Jeans mit grauer Wuschelfrisur und hob müde die Hand, um seine Fans im Podium zu grüßen. Der Literaturkritiker der „Süddeutschen Zeitung“ hielt sich auch nicht lange damit auf, Inhalt und Form des neuen Buches von Paul Auster einzuordnen, sondern beschwor zitatensicher und wortgewandt das sogenannte „Paul Auster Feeling“, unter dem sich jeder der anwesenden Zuschauer etwas anderes vorstellen konnte.
Читать дальше