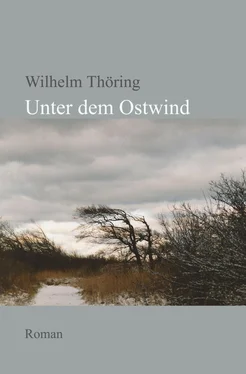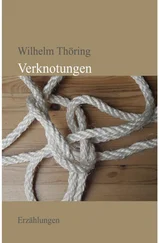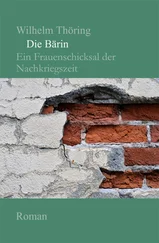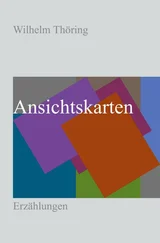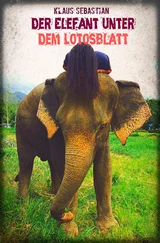Diese alte bucklige Hexe! Warum lass ich mich von der Alten bloß erschrecken und kopfscheu machen? „Du alte Krähe, du!“ ruft sie hinterher. „Du bist ja nicht bei Trost!“
Sie rennt zu den Kindern in die Stube und reißt die Zwillinge an sich. Sie drückt sie so fest, dass sie Angst bekommen und zu brüllen anfangen.
„Sie ist doch nur neidisch“, sagt sie. „Dieses Waschweib! Hat nie Kinder gehabt. Sieht gelb und grün auf die, die welche im Haus haben. Hexe!“
Der Mann steckt seinen Kopf durch die Tür. „Warum schimpfst du, Malchen?“
„Die Bucklige, die alte Hexe ... Kommt daher und jagt mir einen Schrecken ein, dass mir ganz elendig wird!“
„Nun, wenn du sie nicht davonjagen kannst – dann lass sie doch einfach stehen und gehe weg.“
Als sie wieder bei der Arbeit ist, hält sie Ausschau nach der buckligen Wanda. Die Alte hat mit ihren Worten etwas in Amalie eingepflanzt, das sie nicht ausreißen kann. Den ganzen Tag gehen ihr die Drohungen durch den Kopf.
Später im Bett, als sie auf den Schlaf wartet, da springt die Angst sie wieder an und wird noch drückender; sie hat vorhin mit ihrem Mann darüber sprechen wollen, aber der hat sie nur ausgelacht und ist gleich eingeschlafen.
Heute gibt es einen schönen Tag. Nach dem Regen in den letzten Tagen ist die Erde grün geworden; so weit das Auge sehen kann, sieht es schwarzen fetten Boden, vereinzelt von einem hellen grünen Schleier überzogen.
Jendrik Erdmann kommt mit aufgekrempelten Ärmeln in den Hof. Er ist braun geworden, seitdem er draußen an seinem Haus arbeitet. Morgen wird er die Wand mit Lehm abdichten können. Den abgeschlagenen Putz hat er von den Kindern zerkleinern lassen und ihn dann in einem Zuber aufgeweicht. Jetzt ist er soweit, dass er verarbeitet werden kann.
Aus dem Haus dröhnt das Stoßen und Stampfen der Webstühle, an denen der Gehilfe Witold mit den drei größeren Kindern arbeitet. Der dreizehnjährige Berthold, den Amalie nur liebevoll Bertel nennt, hat sehr früh für nichts anderes Interesse gezeigt als für die Webstühle, für das Haus und den Hof. Jedem Besucher erklärte er, und da war er erst ein fünf- oder sechsjähriges Kind, das auf seinen nackten fleischigen Füßen herumpatschte, dass dies einmal sein Hof, sein Haus und seine Webstühle sein werden. Er konnte es am wenigsten erwarten, endlich wie die Großen weben zu dürfen. Seine um ein Jahr jüngere Schwester Adelheid versucht, so ausdauernd wie der Bruder hinter dem Webstuhl zu sitzen. Wenn sich aber eine Gelegenheit findet, den Platz verlassen zu können, dann verschwindet die Adelheid und vergisst die Arbeit. Mit Rosa, dem dritten Kind, müssen die Eltern nachsichtig sein. Obwohl die Rosa in diesem Jahr elf wird, ist sie ein fünfjähriges Kind geblieben. Blass ist sie und schwach und immer kränklich. Sie klagt oft über Schmerzen im Bauch und über ein Stechen im Kopf. Manchmal kann sie morgens die Augen nicht öffnen, weil sie von Eiter verklebt und verkrustet sind und sie quälen.
„Rosa, mein Kindchen, bleibe liegen“, beruhigt Amalie das wimmernde Kind. „Ich werde dir mit lauwarmem Tee die Augen auswischen. Und wenn das nicht hilft, dann werde ich zum Arzt gehen.“
Aber Rosa weigert sich jedes Mal, im Bett zu bleiben. Gleich nach dem Frühstück hockt das Kind wieder auf der Bank des Webstuhls und lässt auf seine langsame Art die Schiffchen laufen. In die Schule kann sie nicht gehen, weil sie nur schwer begreift, was man von ihr erwartet und weil sie die Augen nicht anstrengen darf.
Der Berthold will nicht in die Schule. Wenn man nur ordentlich weben und dazu noch seinen Acker bestellen kann, meint er, das reiche fürs Leben. Er hat nur so viel gelernt, dass er ein wenig lesen und ein paar Buchstaben schreiben kann. Hingebungsvoll hat er, wenn er Lust dazu hatte, seine Unterschrift geübt, die er gekonnt hinmalt, wenn es einmal sein muss. Ganz anders verhält es sich mit dem neunjährigen Edmund. Er besitzt einen raschen und wachen Verstand, der sich für jede noch so simple Arbeit allerlei Erleichterungen oder Verfeinerungen ausdenkt. Es gibt aber niemanden, der sich seine Schnapsideen, wie der Vater sie nennt, anhören will. Nein, wenn Edmund auftaucht und seine Hilfe anbietet, dann ist bei den Leuten sofort eine Gereiztheit zur spüren. Sie winken ab und schicken ihn schnell wieder weg, und man ist froh, ihn ohne großes Lamento, ohne seine bohrenden Wenns und Abers losgeworden zu sein.
Jendrik steht in der Frühlingssonne und lauscht auf das Klopfen, auf das Durcheinander und das Gegeneinander der Webstühle. Bald wird er sieben Webstühle hören können! Expandieren nennt sein Bruder das; aber Jendrik weiß nicht, was es bedeutet, und den Bruder fragen, das mag er nicht, um nicht verlacht zu werden; ja, expandieren, das will Jendrik auch. Der Bruder erinnerte ihn: ‚Haben nicht alle Erdmanns vor ihm ebenso gedacht und gehandelt? Damit haben sie uns ein ansehnliches Anwesen hinterlassen, das der Familie Respekt im Ort verschafft und ihrem Wort in den Versammlungen ein gewisses Gewicht gegeben hat.’ Ja, Jendrik will sich ebenso wie seine Vorfahren darum bemühen, das, was er übernommen hat, zu vergrößern. Er wird seinen Besitz vermehren und somit dem Namen und dem Ansehen seiner Kinder im Ort noch mehr Wichtigkeit geben.
Er beobachtet eine Katze, die, ein Junges im Maul tragend, vorsichtig aus dem Fenster des Geflügelstalles in den Hof springt.
Ja, so ist das unter dem Dach seines Hauses: hier drängt in jedem Winkel Leben ans Licht, immerzu, als läge nur darin der Sinn.
Die Leute rüsteten sich für den Bittgottesdienst, denn der Mai geht zu Ende.
In jedem Jahr kommen am letzten Maisonntag die Menschen aus der Stadt und dem Umland zu diesen Bittgottesdiensten zusammen, um derer zu gedenken, die zuletzt vor über dreißig Jahren, das war im Jahre achtzehnhundertsechsundsechzig, von der Cholera dahingerafft worden sind. Katholiken und Protestanten, Deutsche wie auch Polen machen sich gemeinsam auf. Einträchtig fahren dazu unterschiedliche Familien in einem Wagen in die Stadt. Vor der eigenen Kirche verabschieden sie sich, um hernach in der Weise, wie sie gekommen sind, auch wieder den Heimweg anzutreten. Dieses gemeinsame Fahren hat noch einen anderen Grund.
Damals, das hatte jeder von den Älteren noch lebhaft im Gedächtnis, starb allein in dieser Stadt ein Zehntel der Bevölkerung. In wenigen Monaten war der Friedhof belegt, und als man nicht mehr wusste, wo man die Toten begraben sollte, kam von der Starosterei die Verfügung, dass jeder Bürger zur Erweiterung des Friedhofs zwei Rubel an die örtliche Verwaltung zu entrichten habe. Mit diesem Geld wurde dann in aller Eile der Friedhof erweitert und auch gleich ein zweiter geplant. Nach einem guten Jahr war dieser zweite Friedhof dann so weit hergerichtet, dass er genutzt werden konnte. Man wollte gerüstet sein für den Fall, dass die Seuche noch einmal auftreten und im Land wüten sollte. Sodann war in die Bittgottesdienste mit der Zeit noch etwas ganz anderes hineingekommen.
Es gab vielfältige Nöte, die die Menschen drückten und ihnen das Leben schwer machten. Lange Winter, in denen sie nicht nur froren, sondern auch erfroren. Und alle paar Jahre gab es Missernten, wie sie sie erst vor kurzem erlebt hatten. Hin und wieder brannte schon einmal ein Haus, und da nicht wenige Häuser aus Holz gebaut waren, breitete sich das Feuer in Windeseile aus und vernichte ganze Viertel oder Straßenzüge. Und oft genug starben Menschen in den Flammen, oder sie wurden von einstürzenden Dächern oder Wänden erschlagen.
Dieses Erleben, solches Wissen floss in die Bittgottesdienste mit ein.
Das Fürchterlichste aber war die Cholera. Sie wurde als ebenso schlimm empfunden wie die Knechtung durch die russischen Usurpatoren.
So wurde in den Bittgottesdiensten am letzten Maisonntag an diese beiden zentralen Ereignisse gedacht: an das letzte Wüten der Cholera und an den Januaraufstand der polnischen Patrioten gegen ihre Unterdrücker, der sich drei Jahre vor dem letzten Auftreten dieser Seuche ereignet hatte.
Читать дальше