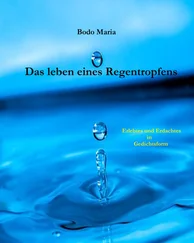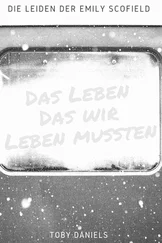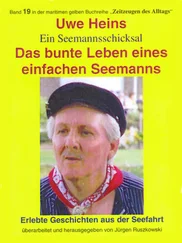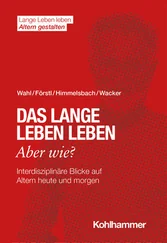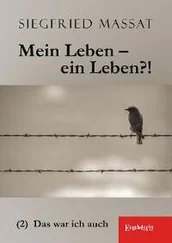Aber es wird sowieso herzlich wenig aus der Geschichte gelernt, wenn man bedenkt, daß so gut wie kein Opfer des Zweiten Weltkrieges, das sich nicht später bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit als Täter gemausert und stehenden Fußes die eigene Befähigung und Berufung, selber Grausamkeiten und Frevel zu begehen, durchaus überzeugend unter Beweis gestellt hat. Werfen Sie mal einen Blick auf die Nachkriegsgeschichte kurz davor Niedergeworfener und Besetzter, also die Geschichte Belgiens, Frankreichs, Hollands und so fort und so weiter. Es mag sein, die Grundvoraussetzung zu einem sittlichen Bewußtsein reicht weiter zurück als bloß geschichtliche Erkenntnis, oder tiefer, zu vielleicht etwas Angeborenem. Wissen Sie noch, was Stifter Stephan Murai in Brigitte darüber sagen läßt, was ihn von der Laufbahn als Professor abbrachte? Nicht jeder kommt auf die Welt mit der einschlägig ausschlaggebenden Ausstattung, das heißt mit einem großen Herzen. Das Wissen hat offenkundig einen zweifelhaften Wert. Aber ich schweife ab und daher breche ich auch ab, zumal ich durchaus nicht so verstanden werden will, als einer unter denen, die Gerechtigkeit in der Welt erwarten und sich über historische Missetaten empören, als hätten sie in der jeweiligen, unbeirrt Gerechtigkeitssinn fordernden Lage selbstverständlich mutiger und ehrenhafter gehandelt. Enttäuscht zu sein in derlei an andere gestellten Erwartungen signalisiert in der Gegenwart zumeist ein abwartendes Verhalten, das letztendlich wegen der darin enthaltenen, verleitend verlogenen, eitlen Selbstüberschätzung die Einschränkung, die bedingte Bereitschaft besagt, das Gute nur dann zu tun, solange die anderen auch gut sind.
Ich verlange keine Gerechtigkeit, denn, was noch hinter Gerechtigkeitserwartungen steckt, ist ein Mangel an Vorstellungskraft, die selbstverständliche Annahme, daß das Universum (allenfalls durch irgend etwas noch Unbekanntes, nichtsdestotrotz Wirksames) so ordentlich konstruiert worden sei, daß es für eine auch immer aufgefaßte Gerechtigkeit, für ihre Entstehung, überhaupt für den Begriff schlechthin gesorgt sei. Mit dem vorrückenden Alter lernt man, oder es wird einem zunehmend vergegenwärtigt, daß nichts aber auch gar nichts auf dieser Welt und in dem Universum selbstverständlich ist. Und Empörung, vor allem offen zu Tage getragene, lauthals vorgetragene Empörung ein Zeichen dafür ist, daß man aufgrund mangelnder Einbildungskraft nicht weiß, worin man eigentlich verstrickt ist. Denn, daß man sich mit Empörung auf eine mitgemeinte Ordnung stützt, die es gar nicht geben muß, sich also auf die weiter gefaßte Annahme beruft, daß irgendwo eine vorgezeichnete, fest verankerte, für alle verbindliche, unserer aller Seele in Wohlgefallen sich auflösende, endgültig zufriedenstellende, kurzum vollkommene Daseinsgestaltung irgendwo unumstritten Bestand habe und dies auch noch irgendwie heraufzubeschwören sei, zu deren Verwirklichung und Erfüllung Gerechtigkeit als ein unentbehrliches Mittel ausgeübt werden müsse. Dem Leben wird von denen das Meiste abverlangt, die davon am wenigsten verstehen, ausgerechnet dies, in einem Maß, daß einem die Augen richtig übergehen.
Es gibt aber keine Einrichtung, Unternehmung oder Daseinsvorstellung, die sich nicht vor unseren wachen Augen auflösend “von Klippe zu Klippe” in tiefe Abgründe zu stürzen droht. Und da hilft Gott nichts, auch der fromme Meister Eckhart vermochte keinen Gott aufzufassen, der das eigene Sein rechtfertigen konnte und darauf hin das Sorgekind, den Menschen erfunden habe, um eben in der Sorge um den Menschen aufzugehen. Sollten in diesem Sinne Gedanken über die Beschaffenheit der Welt einmal Fuß fassen, kommt man davon zuweilen nie ganz wieder weg. Was ich davon in meinem späteren Denken bewußt beibehalten habe, ist eben, daß Gerechtigkeit kein Endzweck sein kann, und zu ihrer Entstehung ein ihr vorangehendes, über sie hinausgreifendes Fertigwerden mit den Dingen im allgemeinen vonnöten ist. Das sieht man am ehesten daran, daß Gerechtigkeitsbestrebungen nämlich darauf hinarbeiten, sich eben wahr zu machen, in Erfüllung zu gehen, das ist nun, sich eben überflüssig zu machen, und wenn es soweit ist, was dann? In einer ringsum völlig abgesicherten Existenz Däumchen drehen? Diejenigen, die nicht so weit vorausgedacht haben, und darum wegen der eigenen Rechtschaffenheit und Gerechtigkeitsforderungen auf sich aufmerksam wollen, haben sich entblößt. Sollte man von Gerechtigkeitsvorstellungen nicht ablassen, so lieber nach dem chinesischen Sprichwort: “Üb’ Gerechtigkeit, erwarte keine.” Zum äußersten getrieben kann diese Haltung allerdings bedeuten, daß man für Dinge sterben muß, für die man aber nicht leben will oder kann. Tatsache ist, man tut Gutes, nicht weil die Welt gut ist, sondern allzu oft gedächtnismäßig unauslöschlich grauenhaft, nicht weil der Mensch gut ist, sondern schwach–schlecht, und nicht weil einer selbst gut ist sondern, weil man keine Lust hat, sich vor sich selbst zu ekeln. Wenn dabei Eigennutz eine Rolle spielt, dann in dem Sinne, daß man durch sein bescheidenes Zutun in einer rundum etwas weniger mißlichen Lage leben darf. Dazu schöpft man Kraft von der ganzen Hoffnungslosigkeit und letztendlicher Vergeblichkeit. Man bleibt eben gefaßt in dem Bewußtsein, am Ende ist nichts zu verlieren. Oder vielleicht doch: Wer nicht weiß, daß er/sie eine verlorene Seele ist, hat überhaupt keine, oder ist eine verwöhnte, eine dumm–verderbte, ein armer Wicht eben. Das Maß des metaphysischen Mißbehagens ist schließlich das Maß des Menschen schlechthin. Wenn dies alles, d.h. also die niedergeschraubten Erwartungen zur Kenntnis genommen und verinnerlicht wird, entdeckt man eine ausgesprochen wohltuende Nebenwirkung: nervenzerreibende moralische Empörung wird durch einen die Seele verschonenden Gleichmut abgelöst. Was zu diesem Zustand führt, ist die Einsicht, daß man langjährig die eigene größte Baustelle sein muß, die wiederum in der Erkenntnis besteht, die gute Tat ergibt sich einzig und allein aus Trotz, sonst liegt man grundfalsch, was nun mal die Grundbeschaffenheit des Guten anbelangt. Und die wirkt bisweilen wie ein kopfloser Tanz aus der Wirklichkeitsreihe ins Nichts.
Meinen bisherigen Ausführungen entnehmend wird der Leser sicherlich darauf gekommen sein, nicht nur daß ich meines Zeichens Germanist bin, das liegt auf der Hand, aber dies mit Leib und Seele, Haut und Haar. Ich liebe die ganze Bandbreite deutscher Philosophie und Literatur, und finde, wenn es sie nicht gäbe, wäre es eben nötig sie zu erfinden. Aber man unterliegt beruflichen Auflagen als Germanist und wird gezwungen, sich auf ein Gebiet, oder noch enger auf einen Autor zu spezialisieren. Meine Fachidiotie läuft unter dem Namen Franz Kafka, da bin ich eigentlich nicht schlecht aufgehoben. Immer wieder bei einer Auseinandersetzung mit Kafka zu landen, den ich für den bei weitem größten Romancier des 20, Jahrhunderts halte, ist Auslastung genug. Das besagt aber nicht, daß ich ihm alles abkaufe. Seine Einsicht in die “Unmöglichkeit des Lebens” ist etwas, dem ich doch nicht nur nicht zustimme, sondern wogegen ich mich mit allen Mitteln sperre und sträube. Da bin ich vielleicht einer eher ordinären Anhänglichkeit an das das Leben verfallen. Aber lassen wir das vorerst beiseite, es tut nichts zur Sache, denn ich bin längst nicht die Hauptperson in den vorliegenden Erzählungen und meine Meinungen sind ohnehin nicht so gewichtig, wohl aber eine mir eigene Beobachtungsgabe.
Was die Details meiner Person anlangt, reicht es, daß Einiges zur Kenntnis genommen wird. Daß ich zum Beispiel reichlich Zeit gehabt habe, über das, das was sich noch heute zutragen wird, nachzudenken und die destillierten Ergebnisse davon niederzuschreiben. Daß ich ein mäßig einsichtvoller intelligenter Mensch bin, mit ausreichendem Maß an Bildung, um das intellektuell einzuordnen, was ich noch erleben und erfahren werde und vor allem mir mitgeteilt werden sollte, halte ich mir zugute. Ich bin aber zugleich auch nicht bar jeder Lebenserfahrung und dermaßen in Gelehrsamkeitswahn verrannt, daß ich glaube, daß das größte Abenteuer sich ausschließlich zwischen den Ohren abspielt: “Dieses ist der Grund, weswegen man nicht selten Gelehrte (eigentlich studierte) antrifft, die wenig Verstand zeigen, und warum die Akademien mehr abgeschmackte Köpfe in die Welt schicken als irgend ein anderer Stand des gemeinen Wesens.” Wer meint, Kant habe keinen Humor, kennt ihn schlecht.
Читать дальше