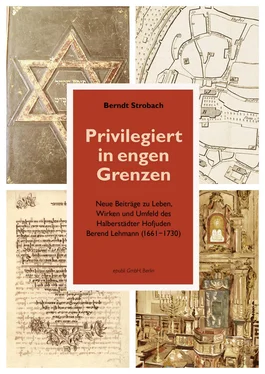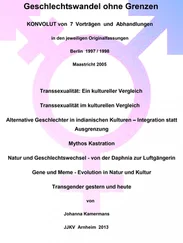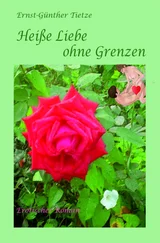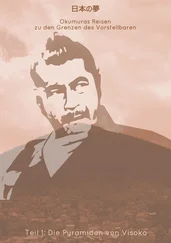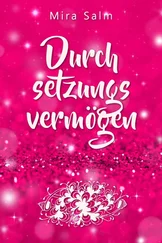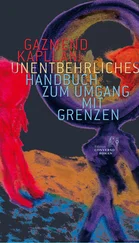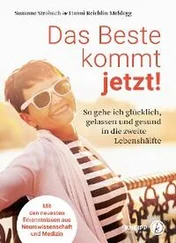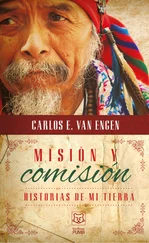Berend Lehmann lässt sich mit der Befolgung des Verbotes Zeit. Am 24. November 1702, also über drei Jahre später, ist Heister-2 nach wie vor in seinem Besitz, weil der Verkäufer, der Regierungsrat Koch, ihm die Kaufsumme immer noch nicht „restituirt“ hat. Als Lehmann sich deshalb beschwert, befiehlt der König seiner Halberstädter Regierung, „dem Supplicanten ohne weitläufigen Prozeß zu dem Seinigen zu verhelfen“.
Inzwischen hat der Resident sich in dieser Gegend weiter umgetan: Er kauft, ebenfalls 1699, mit allerhöchster Genehmigung, 174dieses Mal von dem Regierungsrat Pott 175das unmittelbare Nachbarhaus von Schacht und Heister-2 ( M ), 176allerdings macht man ihm zur Bedingung, dass er Heister-2 räumt, was vermutlich lange Zeit nicht geschieht.
Heister-2 und danach Pott sollten nach dem Willen der königlichen Regierung in Berlin offensichtlich der jeweilige Ersatz für das von der Lehmannschen Familie um 1700 bewohnte und aufzugebende Haus sein. Dass Lehmann auf das wahrscheinlich seit 1690 bewohnte Haus Bakenstraße 37 links ( A ) dennoch nicht verzichtet hat, beweist der Vermerk im Anhang der Liste von 1699, er besitze das eben erwähnte Pottische Haus zusätzlich zu jenem „am waßer“ („noch ein anderes“). 177
Hätte er „Schacht“ mit dem Klaus-Hinterhausneubau zurückerhalten, so wäre zusammen mit „Pott“ und „Heister-2“ ein genügend großes Grundstück für einen Synagogen-Neubau vorhanden gewesen. Da er an „Schacht“ nicht wieder herankommt und „Heister-2“ ja wieder verkaufen soll, ist die Gegend zwischen Grauem Hof und Rosenwinkel offenbar für ihn uninteressant geworden (Vgl. Abb. 13: Blick vom Grauen Hof auf die große Synagoge).
1721 ist außer von ,Klein Venedig’ (Bakenstraße 37) nur noch von einem Garten samt Gartenhaus als seinem Immobilienbesitz die Rede; dieser könnte ein zurückbehaltener Rest des Pottischen Grundstücks gewesen sein, der in der folgenden Episode eine Rolle spielt. 178
Das Gartenhaus an der Stadtmauer
Dieses kleine Gartengrundstück befand sich jedenfalls in unmittelbaren Nachbarschaft des nunmehr von dem Hugenottenprediger Rossall 179bewohnten „Schachtischen Hoffes“ ( F ). Seine Lage lässt sich sogar noch genauer bestimmen: Es lag 180unmittelbar an der Stadtmauer nördlich des „Schachtischen Hoffes“; an der Außenseite der Stadtmauer befand sich dort – von der Stadt her gesehen – hinter dem Stadtgraben (der heutigen „Promenade“) ein Teich und wiederum dahinter „Garten und Kamp“ des Geheimen Etatsrates und Generalkriegskommissars Freiherr von Danckelmann. 181Der Garten lag „hinter der Juden Synagoge“ ( G ), die jetzt erneut erwähnt wird.
Die Grundstücke könnten folgendermaßen zueinander gelegen haben:
[no image in epub file]
Der Resident baute auf diesem Gartengrundstück, wie er selbst in einer Eingabe an den König im Februar 1708 darstellt, unter der Verwendung von Resten eines vorhandenen baufälligen Fachwerkgebäudes ein zweistöckiges Gartenhaus „zu mehrerer Bequemlichkeit und Conservation der Gewächse“. 182Es ist fast fertig, als der Hugenottenprediger sich darüber beschwert, dass dieses „Lusthaus“ seinen Besitz „ganz unfrey“ mache. Die Traufe dieses Hauses rage weit in sein Grundstück hinein und nehme den Bäumen seines Gartens „Thau und Regen“. Außerdem findet der Geistliche, das Haus stehe so nah an der Stadtmauer, dass man vom Fenster des Oberstockes aus mühelos die Stadtmauer überwinden könne, so dass „allerhandt unterschleiff und defraudationes [Betrug] bei der Accise* [...] zu besorgen“ seien. Auch die Halberstädter Verwaltung befürchtet, dass auf diese Weise unverzollte Waren und Menschen (unvergleitete Juden?) geschmuggelt werden könnten. 183
Daraufhin hatte Berlin bereits 1707 angeordnet, der Weiterbau sei zu „inhibiren“ (aufzuhalten).
Nun ist der Winter 1707/08 vorüber, und Berend Lehmann möchte – hier genauso wie an der Peterstreppe ( B ) – endlich den Bau zu Ende führen dürfen (vgl. Dok. 13), 184zumal, so schreibt er, „auch fast alle garten Gewächse Verdorben und ruinirt sind“. Er habe seinerzeit sofort gegen die „Inhibition“ protestiert (in den Akten nicht erhalten) und darum gebeten, die beiden „Hoff und Regierungs Räthe von Meisenburg 185und Kochen“ in der Sache gutachten zu lassen (Koch ist auch der Vorbesitzer des von Lehmann erworbenen „Heisterschen Hauses“).
Die beiden Herren hätten schon „für [vor] ezlichen Monathen“ den Neubau in Augenschein genommen. Es fehlt offenbar nur die vom König zu verordnende „Commission“* für das Gutachten.
Die Angelegenheit zieht sich lange hin: Am 29. 8. 1708 bestätigt Berlin erst noch einmal die „Inhibition“ (vgl. Dok. 14), 186. Wenige Tage später 187befinden die beiden Räte nach erneuter Ortsbesichtigung, (vgl. Dok. 15), es handele sich zunächst einmal nicht um einen Neubau, wie er Juden zu jener Zeit verboten war, sondern nur um die Ersetzung eines vorhandenen Gebäudes. – Lehmann habe auch nicht einmal, wie er normalerweise gedurft hätte, die Trennmauer zwischen seinem und des Predigers Grundstück, die ihm gehört, als eine Wand seines Gartenhauses benutzt, sondern eine neue Wand aufführen lassen. Die „Contradiction“ des Predigers habe in diesem Punkt „keinen Grund“.
Regen könne das Haus nur dann abhalten, wenn er „aus Mitternacht“ käme (also von Norden, eine für Halberstadt ungewöhnliche Wetterlage); die Gefahr der Überwindung der Stadtmauer sei nicht größer als bei vielen anderen Halberstädter Häusern. Die Distanz Fenster – Mauer betrage auch immerhin 6 Ellen (mindestens 3,60 Meter); vor der Mauer lägen ja auch noch der Stadtgraben und ein Teich. Also auch hier kann der Prediger nicht punkten.
Über Herbst und Winter hört man nichts von der Sache. Im Februar 1709 bohrt der Resident noch einmal nach: Man möge ihm doch endlich erlauben, das Gartenhaus zu Ende zu bauen. Er wolle es auch gar nicht, wie behauptet, als „Lusthaus“ benutzen, sondern nur als Schutzraum für seine Gewächse. Die Gutachter hätten sich doch von seiner Ordnungsmäßigkeit überzeugt, und dem Hugenotten wolle er insofern entgegenkommen, als er den Dachüberstand verringern und damit die Traufe „in etwas einziehen“ werde. Auf die entsprechende Anfrage aus Berlin übermittelt Halberstadt nun endlich den Bericht (vgl. Dok. 16), 188und Ende März berichtet die Halberstädter Verwaltung nach Berlin (vgl. Dok. 17), nach erneuter Inaugenscheinnahme sei in Bezug auf Berend Lehmanns Gartenhaus nun „nichts mehr zu erinnern*“. 189
Dass es hier zu einer Konfrontation eines Juden mit einem Reformierten gekommen war, lag sicherlich nicht an einem Ressentiment Lehmanns gegenüber den Reformierten. Wurde ihm doch von seinem wichtigsten reformierten Zeitgenossen in Preußen, dem Hofprediger Daniel Ernst Jablonsky bescheingt, dass er sich als „Principal-Person“ der polnischen Herrschaft Lissa (Leszno), die ihm eine Zeit lang als Pfand gehörte, in besonderer Weise für die dort vom Katholizismus bedrängten Reformierten eingesetzt habe. 190
Ein Jahr nach Lehmanns Tod heißt es in einem Bericht an die Berliner Regierung, Lehmanns nachgelassenes Vermögen bestehe aus „dreyen Häusern, einem Garten, einer Orangerie und einigen meubles“ 191. Die drei Häuser dürften „Klein Venedig“ ( A ), das 1734 an Nathan Meyer verkaufte „kleine Haus“ in der Judenstraße ( Q ) und die Ur-Klaus nahe der Synagoge ( J ) gewesen sein (s. darüber den folgenden Abschnitt), die „Orangerie“ wahrscheinlich nicht mehr das vom Prediger inkriminierte Gartenhaus, sondern ein ähnliches Gebäude im Garten der Ur-Klaus ( R ).
Auf jeden Fall zeigt die Sorge um seine Pflanzen , dass der Resident – vielleicht in Nachahmung seiner adligen Auftraggeber – ein Liebhaber besonderer Gewächse gewesen ist.
Rechts (nördlich) schließt an den Komplex Schacht/Heister/Pott das Grundstück Rosenwinkel 18 an, heute Sitz der Moses Mendelssohn Akademie ( K ). Dass hier zu Lehmanns Lebzeiten noch nicht die Klaus untergebracht war, wird im nächsten Abschnitt erläutert.
Читать дальше