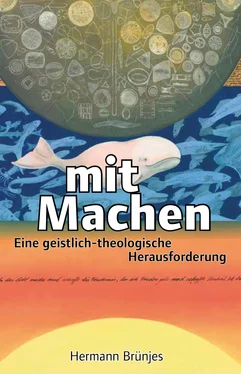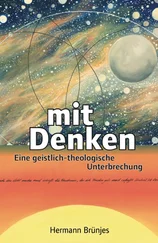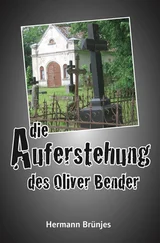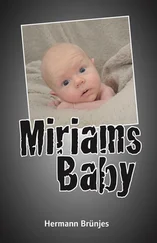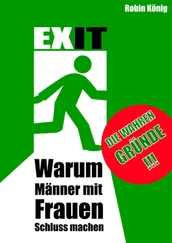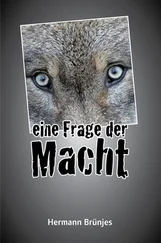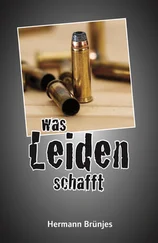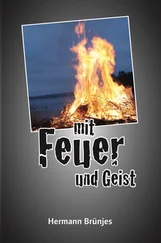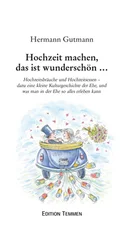Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten sich redlich bemüht, alles zu erfüllen, was Gott von ihnen forderte. Deshalb wurden sie damals als religiöse Führer und Vorbilder durchaus geachtet und akzeptiert.
Ohne Zweifel, viele religiöse Eiferer verdienten Respekt – wenn sie nicht dem Wahn verfallen wären, sie könnten es von sich aus schaffen, Gott gefällig zu sein. Wenn sie nicht letztlich meinten, es läge an ihnen selbst und ihren guten und frommen Werken, den Himmel zu erreichen ... und am Ende bräuchte man vielleicht noch ein bisschen Vergebung für den letzten Rest nicht geschaffter Schuldlosigkeit. Und wieso sollte Gott solche Vergebung vorenthalten, war man doch ehrlich bemüht gewesen und schon so weit gekommen? ... Und am Ende bräuchte man nur noch eine kleine Portion von Gottes Gnade, um den letzten Schritt ins Himmelreich auch noch zu schaffen. Wieso sollte ein gerechter Gott seine Hand zurückziehen, bin ich doch die Leiter schon so hoch geklettert und habe es bis dahin allein geschafft?
Der religiöse (oder humanistische) Eiferer will und muss es selbst schaffen. »Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen!«, so packt er sein Leben und seinen Glauben an und meint dabei noch, besonders christlich zu sein. Allerdings ist sein Motto kein Bibelvers, sondern ein Zitat des Humanisten Johann Wolfgang von Goethe, der diesen Satz in Faust zweiter Teil, Kapitel 63, einem Engel in den Mund legt. In der Bibel steht nichts davon.
Jesus selbst ist die »bessere Gerechtigkeit«
In Matthäus 5,20 ist von einer » besseren Gerechtigkeit« die Rede als jene, die von Selbsterlösung gekennzeichnet ist. Christen beziehen sich nicht auf die eigene, sondern auf eine fremde Gerechtigkeit. Dietrich Bonhoeffer schreibt: »Weil aber diese Gerechtigkeit nicht nur ein zu leistendes Gut, sondern die vollkommene und wahre persönliche Gottesgemeinschaft selbst ist, darum hat Jesus nicht nur die Gerechtigkeit, sondern er ist sie auch selbst.«
Jesus hat den Willen Gottes nicht nur ohne Einschränkungen konsequent gelebt, er war bereits vorher völlig eins mit seinem Vater. Er verkörpert nicht nur die Liebe, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb ist er jene geschenkte »bessere Gerechtigkeit« in Person.
Man kann es nicht radikal genug sagen: Nur durch Christus ist der Zugang zu Gott für uns Menschen offen. Er ist nicht Wegweiser, sondern Weg (Joh. 14,6), ist nicht Türöffner, sondern Tür (Joh. 10,9). Durch Christus ist das »Reich (Gottes) herbeigekommen.« (Mk. 1,15). »Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« (Mt. 4,17). In dieser immer wiederkehrenden und von allen Evangelisten bezeugten Verkündigung sprach Jesus genau genommen von sich selbst.
Ich finde, »Himmel« ist eine wunderschöne biblische Metapher für das Reich Gottes und die Gemeinschaft mit dem Vater und Schöpfer allen Lebens. Was im Englischen »sky« genannt wird, ist damit natürlich nicht gemeint, sondern »heaven«. Der Himmel ist kein geografischer Ort, irgendwo »oben« im oder über dem Weltall. Himmel ist dort, wo Gott mit uns Gemeinschaft hat. Himmel ist dort, wo Jesus ist, weil er allein diese Gemeinschaft ermöglicht und schenkt. Und eben nur dort ist die »bessere Gerechtigkeit« zu haben.
Auch Dietrich Bonhoeffer verknüpft die »bessere Gerechtigkeit« und Jesus Christus miteinander. Folglich bekommt man sie nicht durch eigenes Tun und Machen, sondern nur durch die Beziehung mit Jesus – und die nennen wir »Glauben«.
Wir sind beim dritten »Soli« der Reformation gelandet. Allein aus Gnade, allein durch Christus – es wird sofort deutlich, dass dies mit meinem Handeln und Machen nichts zu tun hat. Ich kann und muss mir den Himmel nicht verdienen. Im Gegenteil: Wenn ich dies meine und behaupte, leugne ich die Güte meines liebenden Vaters und mache aus ihm einen christlichen Erzieher, der mich nur mit ewigem Leben belohnt, wenn ich mich anstrenge und seinem Willen entspreche. Und ich leugne Christus, der eigentlich nicht in diese Welt hätte kommen müssen, da wir Menschen den Weg zum Leben und die Tür zur Ewigkeit ja auch ohne ihn finden und nutzen könnten. Wozu braucht es noch Jesus Christus, wenn meine »Gerechtigkeit« völlig ausreicht, mich zu erlösen und wenn ich ohnehin für den letzten fehlenden Rest einen Anspruch auf Gottes Gnade habe?
Es ist also nicht nötig, immerzu auf meine Verdienste und auf mein Wirken und Machen zu verweisen, wie es jene Ruheständler damals taten. Ich muss mich nicht ständig beweisen und rechtfertigen, weder vor anderen noch vor mir selbst und schon gar nicht noch vor Gott. Zumindest die Anerkennung Gottes bekomme ich nicht durch das, was ich mache bzw. gemacht habe.
Also aus dem Glauben?
Das dritte reformatorische »Allein« behauptet ja genau dies. »So halte ich dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.« (Rö. 3,28). Besonders Paulus hört nicht auf, für den Glauben als Weg zum Leben und zu Gott zu werben.
Allerdings: Ist »Glauben« nicht auch »gemacht«? Ich gehe und sitze, ich bastle und spiele, ich lerne und lehre, ich hoffe und glaube . Glauben ist doch auf jeden Fall etwas Aktives, etwas Gemachtes – oder?
Ja und nein.
»Auf dem Kirchentag treffen sich über hunderttausend evangelische Gläubige!« Weil man auf dem Kirchentag ist, ist man »gläubig«. So sehen es jedenfalls die Medienvertreter. Jemand geht zur Kirche, er oder sie betet und spendet für »Brot für die Welt«. Das sind Gläubige – oder? Man erkennt sie zumindest an ihrem Handeln, Machen und Tun. »Wenn du Christ bist, dann ...«, auch so hört man es gelegentlich. Christsein wird mit guten Taten verbunden, mit Nächstenliebe und Diakonie.
Aus meiner Sicht macht »gläubig« sich meistens an den Äußerungen fest. In manchen Kreisen geht es dabei nicht nur um Frömmigkeit, Moral und gottgefälliges Leben, sondern zusätzlich um die sprachlichen Äußerungen. Wer oft genug »Jesus« sagt, hat gewonnen. »Gott geb’s!« »Gott sei’s gedankt!« Oder die moderne Variante junger Menschen: »Jesus ist einfach geil, und unheimlich super, genau!« Auch christliche Milieus prägen ihre eigene Sprache und definieren jene, die sie beherrschen als »Gläubige«.
Glauben statt Gläubigkeit
Um solchen Missverständnissen ein wenig vorzubeugen, benutze ich statt »gläubig« lieber »glaubend« . Glaube ist aus meiner Sicht etwas völlig anderes als Gläubigkeit. Glaube wird nicht gemacht, sondern er ist ein Geschenk, er ereignet sich. Ohne Ostern und die Begegnung mit dem Auferstandenen konnte Maria nicht glauben (Joh. 20) und ohne das Wunder von Pfingsten wäre nie eine weltweite Bewegung christlicher Gemeinden entstanden (Apg. 2,37f.). Petrus kann sich noch so abmühen mit seiner Gläubigkeit – er schafft es nicht, auf dem Wasser zu gehen! (Mt. 14,22f.) und Paulus wirft es vom Pferd, als er mit Christus in Berührung kommt (Apg. 9). Diese Liste könnte ich jetzt weiterführen. Es ist eine Liste fast ohne Ende. Sie reicht durch die ganze Bibel, dann durch die Kirchengeschichte und bis zu uns im Hier und Heute. Immer wieder wird das Geschenk des Glaubens entdeckt und ausgepackt.
Zur Reformation wäre es ohne die Entdeckung des Glaubensgeschenkes nicht gekommen. Was hatte sich der junge Martin Luther gequält mit seiner »Gläubigkeit«! Das Kloster hatte ihn klein und hilflos werden lassen, ohnmächtig gegenüber dem großen Gott und den noch größeren Ansprüchen an ein frommes und gottgefälliges Leben. Einen »gnädigen Gott« konnte der Mönch nicht glauben. Wie sollte das gehen angesichts seiner, Martins ständigen Gebotsübertretungen?
Doch dann öffnete sich ihm die Schrift. Beim Studium des Römerbriefes und Nachdenken über die »bessere Gerechtigkeit« ereignete sich das Wunder. Martin Luther kam zum Glauben. Der Reformator ergriff Gottes ausgestreckte Hand und ließ sich aus den Fluten seiner Schaffenstheologie ziehen. »Die Pforten des Paradieses waren offen!«, schrieb er später. Plötzlich hatte er so etwas wie einen Schlüssel in der Hand. Und der schloss ihm nicht nur die Bibel und die Überlieferungen auf, sondern sogar die Tür zum Himmel. »Allein Jesus Christus!« Dies wandte er nun konsequent an: Auf die Bibel und die Überlieferungen der Kirche, auf sich selbst und sein Glaubensverständnis, auf seine Theologie und die Ordnungen und Strukturen von Kirche und Gemeinde.
Читать дальше