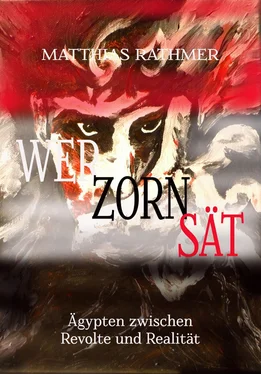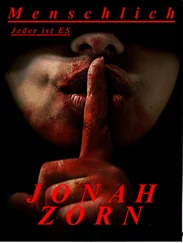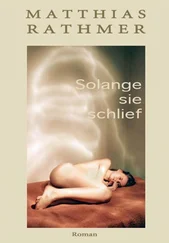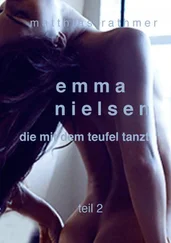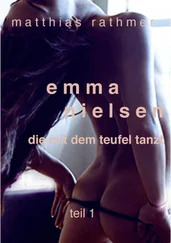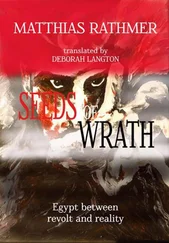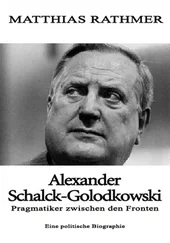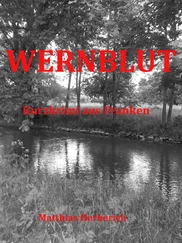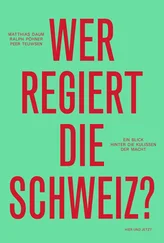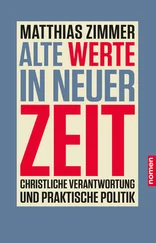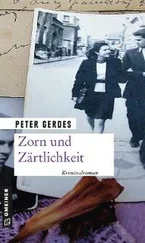„Manchmal denke ich, dass es besser ist, dumm zu bleiben. Wenn man wenigstens glücklich ist.“
Wieder verbot sich jeder Kommentar.
„Aber gut. Wie auch immer.“ Mit diesen Worten begann sie nach einer Weile des Schweigens ihre Ergriffenheit abzulegen. Sie fasste für mich in Kürze die Grundzüge des ägyptischen Schulsystems zusammen und skizzierte den Idealfall einer Schulzeit, die mit dem Beginn eines Studiums oder nach einer entsprechenden Ausbildung im Berufsleben endete. Aus ihrem privaten Umfeld hatte sie dazu Einblick in die Arbeit einer Kommission, die vor kurzem erst Vorschläge für eine Reform an einem Teil dieses Bildungssystems erarbeitet hatte.
So kannte ich sie. Unangepasst und zielstrebig. Zweimal zuvor hatte ich sie im Vorfeld meines Besuchs an ihrer Schule getroffen und miterleben dürfen, wie beliebt sie bei ihren Schülern war. Vorgesetzte wie Kollegen attestierten ihr zusätzlich eine fachliche wie soziale Kompetenz, die derart voller tiefer Anerkennung geäußert worden waren, dass man ob dieser ultimativen Lobeshymnen schon wieder hätte stutzig werden können.
Kennen gelernt hatte ich Rania auf dem Grillfest eines Bekannten. Bereits nach kurzer Zeit hingen alle Kids wie Kletten an ihr, tobte und alberte sie mit ihnen herum, als kannten sie sich seit Jahren. Ich mochte Menschen, die ihrem Beruf mit Begeisterung nachgingen. In Ranias Fall bedeutete diese Hingabe gleichzeitig anstecken zu können. Als Respektsperson kam sie ausgesprochen authentisch daher. Ein Verbot war ein Verbot, eine Mahnung die Vorstufe und Erklärungen der Beginn. Strahlten Lehrer dazu diese ihre Souveränität aus, mit ihrem Mehr an Wissen niemanden zu überfordern und möglichst jeden individuell zu begleiten, durften sie völlig zu Recht Klassenzimmer betreten. Ich hatte bereits eine Menge anderer ausgebildeter Pädagogen getroffen, die zum Wohle aller besser draußen geblieben wären.
Nach der Mathestunde hatten die Schüler einen Einkaufszettel für den Supermarkt angefertigt. Diejenigen, die Banane nicht hatten schreiben können, hatten sie gemalt. Eine knappe Stunde lang. Mama Maggie steckte in einem Verkehrsstau. Weil sie zusätzlich andere Termine drängten, hatte sie ihr Kommen abgesagt. Das bescherte den Kids eine verlängerte Pause, weil der hohe Besuch in ihrer Klasse entfiel, und Rania zusätzlich festzustellen glaubte, dass die Konzentration ihrer Schüler mehr und mehr nachließ, als sie die Ergebnisse aller Schriften über den Erwerb einer gesunden Ernährung kurz nur überflogen hatte.
Wir saßen auf einem Mauervorsprung im Schatten einer Wohnhausruine und blickten auf die kleine Bildungsanstalt, die so Großes leistete. Die vorderen Zimmer hatte die Organisation zu zwei Unterrichtsräumen hergerichtet. Dahinter würde man bestimmt wieder ins Nichts stürzen, dachte ich.
Weil hier keine Straßenkinder schlafen oder essen durften, begann Rania zu erzählen, besaß dieser Ort etwas Magisches, etwas, das alle Beteiligten zu bewahren versuchten wie einen kostbaren Schatz. Vor allem die Schüler selbst. Als es im vergangenen Winter den Slumbewohnern in den Wohnbaracken, die weiter einwärts im Viertel lagen, zu kalt geworden war, hatten sich viele Kids zu einer Nachtwache zusammengeschlossen, um ihre Tische und Stühle zu verteidigen. Die wären sonst als Brennholz verheizt worden. Vielleicht lag der Zauber dieser Energie, so bereitwillig und motiviert um Wissen zu kämpfen, in dem Spürsinn der Straßenkinder begründet, doch etwas für sich und ihre Zukunft zu tun, überlegte ich. Wahrscheinlicher aber war, dass ihnen sonst niemand beibrachte, etwas wertzuschätzen, das kein Geld einbrachte.
Noch immer haderte sie mit sich, schien sie nicht zu wissen, wie sie über das berichten sollte, was unsere Augen nicht sahen. Erst später, als ich daheim die Aufzeichnungen unseres Gesprächs mehrfach angehört hatte, um die Inhalte aufs Papier zu bringen, entdeckte ich, wie zerrissen sie in ihrer Leidenschaft wahrlich gewesen war.
Während die Kleinen umhertollen und die Haltbarkeit der Bälle ausgiebig testen, die ich auf Ranias Vorschlag als Gastgeschenk mitgebracht hatte, beschäftigen sich die Teenager aus der Klasse streng getrennt voneinander. Zwei Jungs versuchen sich eifrig daran, die gleichfalls überlassene Frisbeescheibe in eine taugliche Rotation zu bringen. Die drei Mädchen der Klasse beobachten sie. Immer mal wieder stecken sie die Köpfe zusammen, tuscheln und kichern reichlich albern. Omar, ein dreizehnjähriger Junge, der im Unterricht auffällig still gewesen war, sitzt abseits und liest in einem deutschen Lesebuch, das er mir noch vor dem Unterricht gleich mit meiner Ankunft erhaben präsentiert hatte.
„Er kann überhaupt nicht lesen,“ kommentiert Rania meine Blicke auf ihn.
„Kann er denn wenigstens schon etwas sprechen?“
„Guten Morgen! Ich bin zwölf Jahre alt.“
„Immerhin! Was, wenn ich versuche ihm beizubringen, dass er in Wahrheit ein Jahr älter ist?“
„Und was nützt ihm das?“
Rania hatte Recht, beginne ich einsichtig über eine Antwort nachzudenken. Es ist besser, ihm, wie sie das tut, Rechnen, Lesen und Schreiben in seiner Sprache zu ermöglichen. Jede Sekunde seiner Aufmerksamkeit wird gebraucht.
„Er hat noch ein Lesebuch aus Finnland und eines aus Frankreich.“ Momente später hilft sie mir. „Es sind Spenden. Und immer, wenn ich sage, dass sie jetzt eine halbe Stunde das tun dürfen, was ihnen Spaß macht, greift er sich eines dieser Bücher.“
„Er hat Spaß daran, Bücher zu lesen, die er gar nicht versteht?“
„Nein! Er will zeigen, dass er mehr lernen will, als wir ihm hier vermitteln können.“
„Verstehe,“ antworte ich, ohne selbst jemals zuvor in einer ähnlichen Lage gewesen zu sein.
Rania schmunzelt, während ich, als ich endlich ihren kleinen Witz begriffen habe, denke, ob und was sie tun könnte, wenn es die Wahrheit wäre.
„Einmal sind seine Eltern gekommen, als er zusammen mit den anderen in der Pause gespielt hat. Sie haben ihn sofort mit nach Hause genommen und gesagt, dass er besser arbeiten sollte, wenn er schon nicht lernt.“
Ich verharre augenblicklich genauso überrascht wie betroffen.
Eine Weile schweigen wir erneut und beobachten ihre Schüler, die in unbändigem Eifer entweder den Bällen oder einer ständig eiernden Plastikscheibe nachlaufen. Selbst Spielen will gelernt sein.
„Sie kommen und gehen,“ setzt Rania schließlich ein. „Manche sind ein halbes Jahr hier, manche ein paar Wochen. Es ist fast immer gleich. Die Eltern kommen dann und sagen, dass ihre Kinder doch jetzt eine gute Grundlage und genug gelernt hätten.“
„Für was?“
„Fürs Leben. Wofür sonst?“
„Sie meinen wohl eher für ihr Leben,“ bemerke ich. „Und was ist mit denen, die tatsächlich auf eine gute Schule gehen könnten?
„Manche schaffen den Sprung. Die meisten nicht. Aber wir kämpfen um jeden.“ Rania gerät nachdenklicher. „Bildung ist in unserem Land überall zuallererst eine Frage des Geldes. Wirst du in Ägypten geboren und kann deine Familie nicht ausreichend für dich bezahlen, bist du von jeder nützlichen Bildung ausgeschlossen. Damit fehlst du der Allgemeinheit. Und zwar unabhängig von deiner Intelligenz oder von deinen Talenten. Für die ägyptische Gesellschaft gibt es dich einfach nicht, weil dir niemand ermöglicht dich einzubringen. Die Straßenkinder in Slums wie diesem sind die, um die sich wirklich keiner mehr kümmert.“
„Warum?“ frage ich zunächst vorsichtig nach und ringe mit den richtigen Worten meiner Fortsetzung, weil ich bemerkt habe, wie nahe Rania ihre Feststellung selbst geht. „Warum ist Bildung in Ägypten so schwierig?“
Rania lacht auf, bevor sie sich, einem Buchhalter gleich, unverkennbar anschickt, ihre Gedanken in eine Ordnung zu bringen. „Die Ägypter setzen einfach zu viele Kinder in die Welt. Jahr für Jahr. Besser gesagt die armen Ägypter. Und dieser Bedarf bringt enorme Probleme. Dann haben wir viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, unter denen wir heute noch leiden. Dann gab es Reformen. Und Reformen der Reformen. Die Oberstufe wurde reformiert, aber nicht die Grundschule. Dann wurden Teile des Grundschulsystems neu geordnet, aber anderes nicht darauf angeglichen. Nur etwa ein Drittel aller Kinder finden einen Platz im Kindergarten. Immerzu wurden und werden nur einzelne Abteilungen anders geordnet. Nie das ganze System. Und jede Reform kostet ja auch Geld. Entscheidend ist, wie viel Geld wir im Jahr für unsere Schulen ausgeben können. Wenn der Staat sagt, dass er das Geld erst einmal anders investieren muss, dann sind wir in der Regel die, die nichts oder nur wenig bekommen. Und das war schon immer so.“ Ihr Blick auf mich besitzt plötzlich nahezu mosaische Züge. „Heute wissen wir zum Beispiel auch, dass unter der Regierung Mubarak, trotz aller Versprechen, Milliarden Dollar zweckentfremdet worden sind. Das war Geld aus dem Ausland, von Hilfswerken. Es war nur für unsere Schulen gedacht.“
Читать дальше