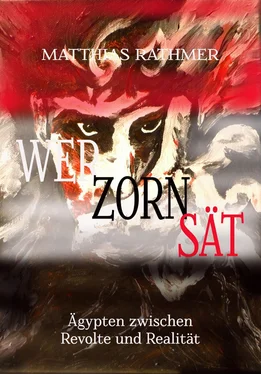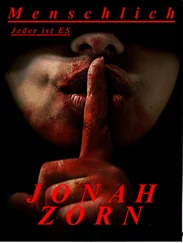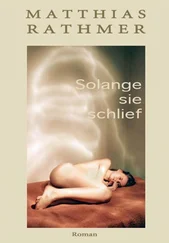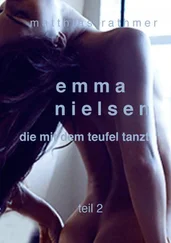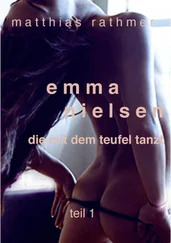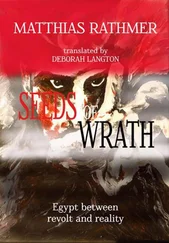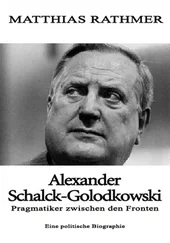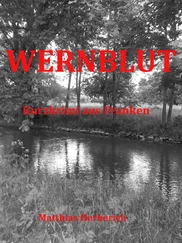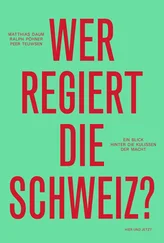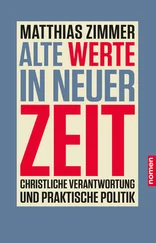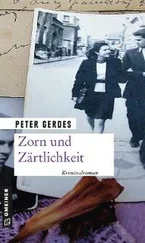Rania ist mittlerweile an den Tisch der kleinen Habir herangetreten. Sie legt zwei Kreidestücke ab, zwei weitere folgen.
Das Mädchen schaut zunächst mit großen Augen verängstigt hoch. Dann geht ihr Blick langsam auf die weißen, kleinen Tafelstifte, die vor ihr liegen. Sie ringt mit sich, schließt für einen Moment die Augen, lehnt sich zurück und verharrt.
„Das sind keine Äpfel,“ ertönt es sofort hinter ihr mit erhellendem Ausdruck unbekannter Herkunft.
„Habir! Zwei und zwei sind...“ Rania versucht geduldig zu helfen und legt ein weiteres Mal alle vier Kreidestücke zusammen. Sie hockt sich vor den Tisch, um auf Augenhöhe zu sein.
„Ich... Ich weiß es nicht,“ schluchzt die Kleine plötzlich auf und vergräbt verschämt ihren Kopf zwischen Hände und Arme. Sie beginnt zu weinen. Kein noch so fürsorgliches Wort des Trostes kann helfen.
Es gab viele bewegende Begebenheiten an diesem Tag. Doch mitzuerleben, wie verzweifelt dieses Mädchen war, weil sie eine einfache Rechenaufgabe nicht lösen konnte, war an Ergriffenheit nicht zu überbieten. Später, als sie mit ihren Freundinnen in einer Pause um die Ecken flitzte, rief sie allen ständig die Antwort zu. „Vier! Vier! Vier! Ich weiß es. Vier!“
Vielleicht war sie nervös gewesen. Möglich, dass sie meine Anwesenheit irritiert hatte. Doch als Rania mir erklärt hatte, dass die kleine Habir erst seit ein paar Wochen regelmäßig zur Schule kam, dass sie dazu eine ausgeprägte Lernschwäche quälte, lag der Verdacht nahe, dass sie in der kommenden Woche wieder Schwierigkeiten haben würde, wenn sie sich geistigen Auges statt zwei mal zwei Äpfeln drei mal drei Bananen gegenübersah.
Ich war in Manschiyet Nasser, einem Stadtteil Kairos etwa auf halbem Weg zwischen dem Zentrum und der Al Azhar Universität am Fuße des Muquattam-Hügels gelegen. Mehr als sechshunderttausend Ägypter leben hier. Der Großteil der Hütten und Behausungen in diesem Viertel war bereits in den letzten Jahrzehnten unerlaubt errichtet worden. Und noch immer zog es jedes Jahr Hunderte, die es anderswo in der Hauptstadt nicht geschafft hatten, in die Ruinen der zumeist nie fertig gestellten Gebäude.
Informell, wie die Stadtregierung sich ausdrückt, haben sich hier auch die Zabbalin angesiedelt, die Müllsammler. Ihre Anzahl kennt keiner genau. Auf siebzigtausend Menschen werden sie geschätzt. Mit ihren hoch beladenen Eselskarren oder oftmals schrottreifen Minitrucks sind sie für jedermann im Straßenbild Kairos sofort erkennbar, sind sie für die Hauptstadt unverzichtbar geworden. Tausende Familien, zumeist koptischen Glaubens, arbeiten nicht nur als zusätzliche Müllabfuhr. Weit mehr haben sie sich auf die Trennung und das Recycling vieler Materialien spezialisiert.
Gleich mit der Einfahrt ins Viertel sind sie unübersehbar, die Berge von Plastikflaschen und Wertstoffen wie Dosen, Becher oder Pappe. Dutzende große, weiße Müllsäcke aus Jute stapeln sich neben- und übereinander. Ansammlungen von Metall, Glas und Essensresten lagern daneben. Elektroschrott, Kabelzüge und Holz liegen dahinter. Werden die Rohstoffe teurer, lungern immer auch mehrere Männer zu ihrer Bewachung herum. Hektische Kommandos ertönen. Schreie rufen zur Ordnung. In den verfallenen Klinkerbauten lagern Tonnen dieses Abfalls, Ecke um Ecke, Straßenzug um Straßenzug. Es riecht widerlich nach Müll, Fäule und Zersetzung. Katzen über Katzen streifen umher. In einem Hinterhofverschlag werden Schweine gehalten. In den Gassen quälen sich unzählige Karren und Laster vor und zurück, alle beladen mit dem, das in der Nacht aus allen Winkeln der Stadt eingesammelt worden war.
Weiter nach Osten liegt die riesige Höhlenkirche St. Sama’an, die größte Koptenkirche im Nahen Osten. Ist sie zu hohen Feiertagen voll besetzt, beten zwanzigtausend Gläubige in beeindruckender Architektur. Auf halbem Weg dorthin hatte ich mich mit ihr verabredet. Sie war pünktlich, wie sie höflich aber bestimmt am Telefon zu verstehen gab, während ich im Taxi saß und warten musste, dass sich der Stau, den ein Kleinlaster mit der Anlieferung seiner Fracht verursacht hatte, aufzulösen begann.
Die Gerüche aus allen Winkeln dieses Viertels waren kaum mehr auszuhalten, ein unerträglicher Lärmpegel dröhnte in die Ohren. Dann und wann flitzten ein paar Kinder und Jugendliche umher, kletterten auf die Halden oder halfen Männern bei der Arbeit. Zentnerschwere Säcke wurden entleert oder gefüllt, um Momente später auf Ladeflächen zu fallen. Auf einem Platz warteten riesige Containertrucks darauf, mit dem Recyclinggut beladen zu werden. Eine Planierraupe und ein Bagger lieferten unentwegt zu. Fiel etwas zu Boden, war schwere Knochenarbeit erforderlich. Endlich. Es ging raus aus diesem üblen Gestank und Getöse. Von weitem konnte ich sie sehen. Sie winkte dem Taxifahrer zu, der neben ihr hielt. Sie stieg ein. Ihre Frische und Dynamik passten so gar nicht zu diesem Umfeld, dachte ich mit unserer Begrüßung. Wie außergewöhnlich dieser Tag tatsächlich werden sollte, entzog sich mir immer noch jeder Ahnung.
Rania ist nicht ihr richtiger Name. Sie bestand darauf, als wir dieses Treffen verabredet hatten, weder ihre Identität preiszugeben noch Bilder von ihr zu veröffentlichen. Sie befürchtete, wie sie meinte, Unannehmlichkeiten mit der Behörde, denn früher oder später würde ich sie nach Zuständen fragen, die das ganze Dilemma der Schulpolitik Ägyptens aufzeigten. Da war Anonymität dienlicher Selbstschutz. Kritische Stimmen gegen das System und ihre Verantwortlichen waren unerwünscht.
Rania war Lehrerin aus einem anderen Stadtteil. Sie war Ende zwanzig, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Einmal in der Woche kam sie hierher, in das Armenviertel Manschiyet Nasser, in die Slums der Müllmenschen, um gemeinsam mit fünf anderen Lehrern ehrenamtlich an einer Schule der Organisation Stephen’s Children zu unterrichten.
Zweigeschossig ist der Bau, mit Fenstern und Türen ausgestattet, was ihn allein schon deswegen im Umfeld der zahlreichen Bauruinen in der Nachbarschaft hervorhebt. Spendengelder und Improvisationskünste haben ihn erstehen lassen. Kommunikationszentrum nennt die Wohlfahrtsgemeinschaft eine Stätte wie diese, einen Ort, an dem es Hilfen aller Art gibt. Neunzig dieser Zentren unterhält die Hilfsorganisation mittlerweile im gesamten Stadtgebiet.
Maggie Gorban, zentrale Leitfigur von Stephen’s Children und Kairos Mutter Theresa, wie sie genauso bewundernd wie ehrfurchtsvoll genannt wird, ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen Ägyptens hinaus bekannt geworden. Die Fünfundsechzigjährige und ehemalige Informatikprofessorin wurde bereits mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert. Seit fünfundzwanzig Jahren setzt sie sich in den sozialen Brennpunkten zwischen Christentum und Islam für die Menschen in den Slums der Stadt ein, fokussiert zwar auf die Kopten Kairos, doch oft genug auch frei von allen Glaubensbekenntnissen. So außergewöhnlich diese barmherzige Seele und Mama aller Straßenkinder war, samt der Perspektive, sie möglicherweise an diesem Tag auch zu treffen, wenn es ihre Zeit und Aufgaben zuließen – gekommen war ich wegen einer anderen Frau. Die saß nun neben mir und rang damit, das ganze Ausmaß eines Desasters in Worte zu fassen.
Es war große Pause. Die Mathestunde lag hinter allen, Lesen und Schreiben stand als nächstes an. Ich verfolgte die Verspieltheit der kleinen Habir. Ihre Tränen waren getrocknet. Fröhlich hüpfte sie umher. Mehrfach eilte sie an uns vorbei und bemerkte noch einmal voller Stolz, dass zwei und zwei vier waren.
„Ich hätte mitweinen können,“ offenbarte Rania unvermittelt, atmete tief durch und sah ihrerseits auf die Unbekümmertheit eines Kindes, dessen Zukunft bereits mit ihrer Geburt abgeschlossen war, wie sie nüchtern angefügt hatte.
Mir fehlte augenblicklich jedes Wort.
Читать дальше