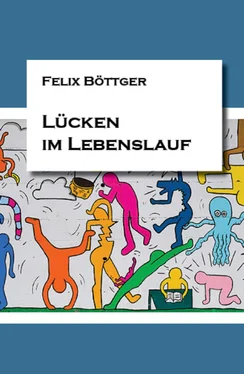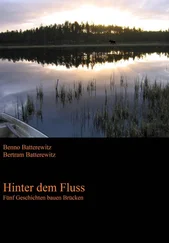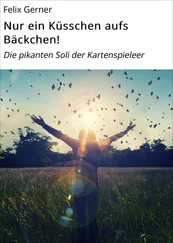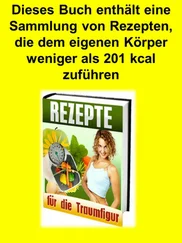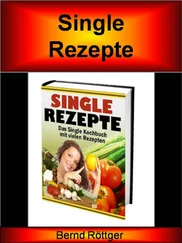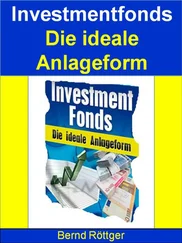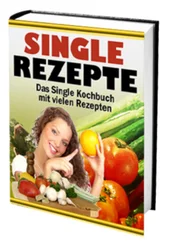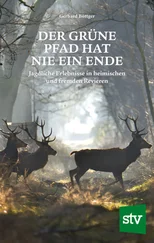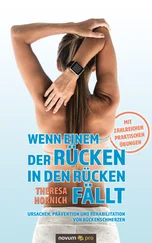Während Dr. Schröder sein Publikum weiter in die akademischen Grundlagen des Projekts einführte, winkte Elif am anderen Ende des Raumes Philipp zu, der ihrer Gestikulation entnahm, dass die erwartete politische Prominenz mit der ihr gebührenden Verspätung endlich eingetroffen war und darauf wartete, von ihm in Empfang genommen zu werden. Philipp huschte aus dem Raum ins Foyer, wo Frau Viraa Karimi von der CDU, seit zwei Jahren Bildungsministerin des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, zusammen mit einem Mann von ungefähr Mitte 30 auf ihn wartete. Frau Karimi war 44 Jahre alt und das Kind iranischer Einwanderer, die vor 39 Jahren nach Deutschland gekommen waren. Sie hatte es von der Integrationsbeauftragten ihrer Partei bis zur Bildungsministerin von NRW geschafft und wurde von Presse und hauptberuflichen Politikexperten als eines der größten politischen Talente der CDU gefeiert, dem eine wichtige zukünftige Rolle innerhalb der Bundespolitik prognostiziert wurde. Den Politikexperten zufolge schlug ihr Herz jedoch weniger für die Bildung, sondern für wirtschaftspolitische Themen. Begründet wurde diese Vermutung damit, dass sie studierte Betriebswirtin war, eine Zeitlang im Unternehmen ihres Vaters (der die erste Halal-Fast-Food-Kette in Deutschland gegründet hatte und es dadurch zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hatte) in geschäftsführender Funktion tätig war und nach ihrem Eintritt in die CDU vor 14 Jahren ursprünglich am Amt des fachpolitischen Sprechers für den Mittelstand interessiert gewesen sein soll, das die Christdemokraten jedoch auch in den 30er Jahren des 21. Jahrhunderts nach wie vor weißen, deutschen, älteren, übergewichtigen, möglichst glatzetragenden Männern vorbehielten, weshalb Frau Karimi den Umweg über den klassischen „weichen“ politischen Karriereweg für muslimische Frauen innerhalb der CDU nahm, und der führte nun einmal über das Amt der Integrationsbeauftragten, und dass dieser Weg Frau Karimi an die Spitze des landespolitischen Bildungsministeriums befördert hatte, war schon ein beachtlicher Erfolg angesichts der Ressentiments der bürgerlichen Mittelschicht gegenüber allen als „Integration“ ausgewiesenen Bestrebungen im schulischen Bereich. Wenn ein Bildungsminister und erst recht eine Bildungsministerin das Wort Integration in den Mund nahm, war dies nach Ansicht vieler Menschen nichts anderes als der Versuch, mit einem politisch korrekten Begriff Eltern darauf vorzubereiten, dass ihre schulpflichtigen Kinder in den fragwürdigen Genuss geringerer schulischer Anforderungen kommen würden. Vielleicht aus diesem Grund hütete sich Frau Karimi davor, das Wort Integration bei öffentlichen Auftritten in den Mund zu nehmen. Philipp vermutete, dass Frau Karimi das Gesetz zur Stimulanz zukünftiger Arbeitskräfte als eine mehr als willkommene Gelegenheit betrachtete, um ihre integrationspolitischen Anfänge hinter sich zu lassen und als bildungspolitische Realistin aufzutreten, die mit neuen Ideen mutig in die Zukunft blickt und sich den gestiegenen Herausforderungen an Bildung und Ausbildung auf den Arbeitsmärkten stellt.
Zumindest so oder so ähnlich hätte es wohl Frau Karimis Pressesprecher formuliert, der, so Philipps Vermutung, die männliche Begleitung von Frau Karimi stellte. Die Bildungsministerin strahlte Philipp an, als sie sich die Hand gaben.
„Herr Weber, schön Sie endlich einmal persönlich kennenzulernen!“, sagte sie, während sie einen für eine relativ zarte Frau erstaunlich festen Händedruck offenbarte. „Darf ich vorstellen, das ist Herr Sandkuhl, mein Pressesprecher, mit dem Sie bereits über Mail Kontakt hatten. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen, aber mein vorheriger Termin hat leider etwas länger gedauert als erwartet.“
„Kein Problem“, bestätigte Philipp pflichtgemäß. „Herr Dr. Schröder spricht gerade noch. Wenn Sie sich beeilen, bekommen Sie das Fazit seines Vortrags noch mit.“
„Gerne, gerne“, sagte Frau Karimi und eilte mit ihrem Pressesprecher in den Raum. Dr. Schröder hatte seinen Vortrag inzwischen doch schon beendet und war gerade dabei, sich abschließend den Fragen der besorgten Eltern zu stellen.
„… Ihre Skepsis verstehen. Aber es kann keineswegs davon die Rede sein, dass wir Ihrem Kind die Kindheit, was auch immer genau wir darunter verstehen, wegnehmen wollen. Unsere Evaluierungsmethoden sind absolut kindgerecht, denn es geht um den spielerischen Umgang mit zukünftigen Herausforderungen. Und zum Spiel gehören nun einmal Regeln und Gewinner und Verlierer. Wir haben schließlich bereits Erfahrungen mit dem Gamifizierungskonzept für die Verbesserung der universitären Lehre im Rahmen von Bologna 2.0 gesammelt. Ich würde sogar behaupten, das Studium ist dadurch menschlicher, nämlich spielerischer geworden. Anstatt der intransparenten Notengebung eines Professors haben Sie jetzt Spielregeln, Punkte, Levelaufstiege – also genau das, was Ihnen bereits im Kindesalter Vergnügen bereitet hat. Und falls Sie das nicht überzeugt, dann versetzen Sie sich doch einmal in die zukünftige Situation Ihres Kindes. Glauben Sie, Sie haben das Recht, Ihrem Kind die vollständige Entwicklung seines Potenzials vorzuenthalten? Natürlich ist es Ihr Kind, aber es geht hier doch um die Zukunft, und in der Zukunft ist Ihr Kind eben nicht mehr Ihr Kind, sondern ein autonomer Mensch, der selbstständige Entscheidungen trifft, und dieser Mensch kann nur dann vollständig autonom sein, wenn er sein tatsächliches Potenzial abrufen kann und nicht das Gefühl hat, aufgrund von Versäumnissen in der Vergangenheit ein Leben zu führen, in dem ständig Möglichkeiten brachliegen, die von ihm niemals wahrgenommen werden. Denken Sie einmal darüber nach, was es für Sie bedeutet hätte, wenn Sie als Kind die Gelegenheit erhalten hätten, Teil eines solchen Projektes zu sein. Denken Sie an die unentdeckten Möglichkeiten, die in Ihnen selber schlummern und die leider niemals geweckt worden sind!“
Dr. Schröder hatte inzwischen registriert, dass Frau Karimi anwesend war.
„Aber wie ich sehe, ist inzwischen Frau Karimi eingetroffen. Nun, ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt mit meinen vielleicht etwas akademischen Ausführungen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie nicht noch weiter warten lassen.“
Mit diesen Worten gab Dr. Schröder die Bühne frei für den prominentesten Gast des heutigen Nachmittages. Frau Karimi schüttelte Dr. Schröder die Hand, tauschte einige Dankesfloskeln mit ihm aus, betrat die Bühne und trug ihre Rede in der für sie typischen Art vor, die sogar von ihren politischen Gegnern anerkennend als unprätentiös und nüchtern beschrieben wurde.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, die Ehre zu haben, gemeinsam mit Ihnen den Start unseres neuen Projekts zu feiern, das die Vorgaben des von der Bundesregierung vor zwei Jahren verabschiedeten Gesetzes zur Stimulanz zukünftiger Arbeitskräfte umsetzen soll. Mit diesem Gesetz nimmt sich Deutschland des Problems der zukünftigen Herausforderungen frühkindlicher Bildung zum ersten Mal auf Bundesebene an. Dies kommt nicht von ungefähr. Wie Sie wissen, nimmt der globale Wettbewerb zu, und aus diesem Grund müssen wir in der Eurokratie die Bildungsstandortfähigkeit stärken und die Bildungsgesetzgebung europaweit harmonisieren, denn Bildung ist, zusammen mit weiteren Strukturreformen, der Schlüssel zu mehr Wachstum in Europa. Gleichzeitig muss der Staat seinen Haushalt konsolidieren, und zu diesem Etat gehören eben auch die Ausgaben für Bildung. Zwar müssen wir die Qualität der Bildung verbessern und dazu auch investieren, jedoch darf dies nicht zulasten der künftigen Generationen gehen. Lassen Sie mich deshalb das Projekt, an dem Ihre Kinderschaft teilhaben wird, ein wenig in den internationalen Zusammenhang einordnen:
Wir haben ein Jahr hinter uns, in dem das Wirtschaftswachstum in fast allen Industrieländern relativ gering ausgefallen ist. Die Weltwirtschaft ist in 2040 insgesamt gerade einmal um ein Prozent gewachsen. Wenn wir von den Krisenjahren 2032 und 2033 absehen, dann ist dieser Wert der schwächste seit zehn Jahren. Ich bin mir wohl bewusst, dass die Lage in der Eurokratie einen Beitrag dazu geleistet hat, dass das Weltwirtschaftswachstum doch sehr überschaubar war. Das hatte vor allen Dingen mit Fragen des Vertrauens, mit Ängsten, die es auch gegeben hat, zu tun. Es kommt aber auch auf die Frage an, wie groß die Reformbereitschaft ist.
Читать дальше