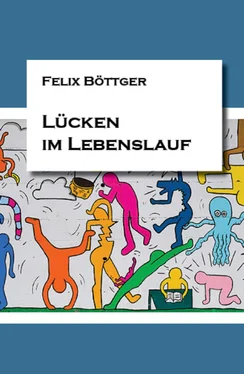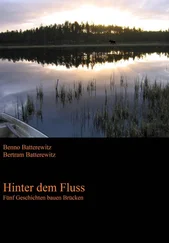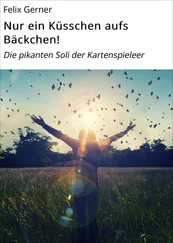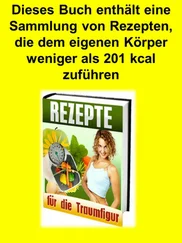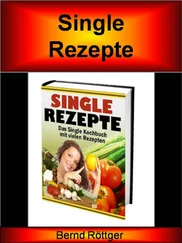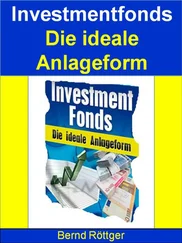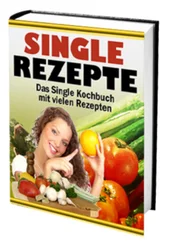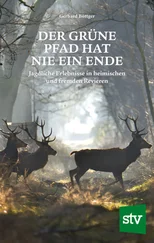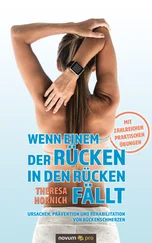Als Philipp die leeren Stuhlreihen abschritt, die Abstände kontrollierte und in Gedanken noch einmal den geplanten Ablauf des heutigen Sonntags durchging, empfand er Dankbarkeit. Dankbarkeit für seine auf zunächst zwei Jahre befristete Festanstellung. Dankbarkeit für seine 42-Stunden-Woche, für seine Renten- und Krankenversicherung, für seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Dankbarkeit dafür, dass er das hatte, was so unspektakulär klingt, jedoch in einer modernen, arbeitsteiligen, flexiblen, individualistischen Gesellschaft so schwer zu erreichen ist: einen geregelten Tagesablauf. Auch wenn sich dieser Tagesablauf mit dem heutigen Tag wohl ein wenig ändern würde, dachte Philipp. Seit drei Monaten war er nun Angestellter in der Kindertagesstätte „Die Stadtmäuse“ in der Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes. Bislang sah sein Tagesablauf nicht viel anders aus als der seiner nicht-akademischen Kollegen: bei Frühschicht um 7 Uhr morgens Arbeitsbeginn, Begrüßung der Kinder und Frühstück mit anschließendem Sitzkreis, dann Beaufsichtigung der spielenden Kinder, um 12 Uhr Mittagsschlaf (der Kinder, nicht der Mitarbeiter). Gegen Nachmittag widmete er sich der Büroarbeit, und danach beaufsichtigte er die dann meistens draußen spielenden Kinder, bis diese abends von ihren Eltern wieder abgeholt wurden. Wenn er Spätschicht hatte, fing er erst um 10 Uhr an und übergab abends gegen 19 Uhr die letzten Kinder an die spät von der Arbeit heimgekehrten Eltern.
Mit dem heutigen Tag sollte sich das jedoch ändern. Philipp war deshalb sehr nervös. Seine Kollegin Elif und er sollten fortan eine neue Generation von Kindergärtnern repräsentieren, die mit dem Gesetz zur Stimulanz zukünftiger Arbeitskräfte in Deutschland Einzug halten würde. Elif war Betriebswirtin, hatte nach Abschluss ihres Studiums eine Zeitlang in einer Marketingagentur gearbeitet und war von der schlechten Bezahlung, den prekären Arbeitsverhältnissen und nicht zuletzt der Sinnlosigkeit ihrer Arbeit (die darin bestanden hatte, in der gesamten Stadt möglichst unauffällig QR-Codes zu verteilen, damit diese automatisch von Smartbrillen ausgelesen wurden – eine Werbestrategie, die von AR-Fachleuten als „Augmented Spam“ bezeichnet wurde) irgendwann derartig abgestoßen, dass sie beschloss, im pädagogischen Bereich Fuß fassen zu wollen, um „irgendwas mit Menschen“ zu machen. Für zwei Jahre arbeitete sie als Honorarkraft in der Pädagogischen Ambulanz, einer Einrichtung, die nicht nur pubertierenden, frisch von zu Hause ausgerissenen Mädchen mit Drogenproblemen als Auffangbecken diente, sondern offensichtlich auch den Mitarbeitern, die zum größten Teil zu denjenigen Menschen gehörten, die sich den üblichen Karrierepfaden in der freien Wirtschaft verweigerten oder beschlossen hatten, diese zu verlassen. So hatten dort neben Elif unter anderem ein Ex-Banker und ein Ex-Logistikleiter gearbeitet, bevor die Pädagogische Ambulanz aus Gründen der Haushaltskonsolidierung ihre Einrichtung schließen musste und von zwei immerhin festangestellten Mitarbeitern als reine Beratungsstelle weitergeführt wurde.
Elif hielt sich nach ihrer Entlassung mit Gelegenheitsjobs im Gastronomiebereich über Wasser und stockte mit Arbeitslosengeld II auf, bis sie im Internet die Stellenanzeige der „Stadtmäuse“ las. Elif und Philipp hatten Glück, dass es seit Bologna 2.0 einen Mangel an ausgebildeten Pädagogen gab und das Gesetz zur Stimulanz zukünftiger Arbeitskräfte ganz bewusst auf pädagogische Quereinsteiger baute, weil es die frühkindliche Förderung auf eine neue Grundlage stellen wollte: Klassisch ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher bauen zusammen mit hochqualifizierten Akademikerinnen und Akademikern die erste Stufe, die unsere Kinder auf dem Weg hin zu einer modernen, der globalisierten Welt angemessenen frühkindlichen Ausbildung erklimmen sollen.
„Und, schon aufgeregt?“, rief Elif Philipp zu, als sie hinter der Bühne hervorkam, wo sie die restlichen Kabel abgeklebt hatte.
„Na, schon ein wenig, und du?“, entgegnete Philipp.
„Nö.“
Du musst auch keine Rede halten, dachte Philipp. Aufgrund seines Studiums galt er als das sprachbegabte, rhetorische Aushängeschild seiner KiTa. Er sollte ab sofort für die Pressearbeit zuständig sein, die Fortschrittsberichte schreiben und mit den zuständigen Beamten korrespondieren. Elif sollte sich wegen ihrer betriebswirtschaftlichen Ausbildung um die eher technischen Aspekte des Projekts kümmern: Evaluationen erstellen und auswerten, eine Fortschrittsanalyse machen, Projektmanagement betreiben – mit anderen Worten all das tun, was sich mittels des nominalistischen Sprachstils des mäßig begabten BWLers zu unerhörter Wichtigkeit aufblasen lässt.
Philipp blendete die Uhrzeit ein. 10.26 Uhr. Noch zwanzig Minuten, bis die ersten Gäste kamen. Der holzgetäfelte Bühnenboden war geputzt, die Kabel waren verklebt, die Abstände zwischen den Sitzreihen kontrolliert, das Mikrofon war angeschlossen und gecheckt und laut den Kolleginnen waren die Kaffeekannen gefüllt. Es war alles vorbereitet.
15 Minuten später begrüßte Philipp zusammen mit Elif und Johanna, einer der älteren Kindergärtnerinnen, die ersten Eltern. Da es sich zumindest in Nordrhein-Westfalen um ein Pilotprojekt handelte, hatte die Landesregierung mit den „Stadtmäusen“ eine Kindertagesstätte ausgewählt, deren Klientel in etwa dem sozioökonomischen Landesdurchschnitt besorgter, ambitionierter Eltern entsprach: hoher Bildungsabschluss, meistens Studium, Anfang 30, beide berufstätig, zumindest einer der beiden prekär im Internetdienstleistungsgewerbe beschäftigt. Johanna bediente sich gekonnt ihrer in jahrelanger Kindergartenarbeit herangereiften Autorität, deren Insignien sie durch weite lila Wollpullover über einem stämmigen Körper unerschütterlich zur Schau stellte, und begleitete die an sonntägliche KiTa-Aufenthalte nicht gewöhnten und deshalb besonders lauten Kinder in die Aufenthaltsräume, damit sie den Ablauf des heutigen Tages nicht stören konnten.
Die besorgten Eltern nahmen vor der eigens für diesen besonderen Anlass im Turnsaal aufgebauten Bühne Platz und fieberten kaffeetrunken der Präsentation entgegen. Die aus solchen Situationen bekannte Geräuschkulisse aus klirrendem Geschirr, gurgelnden Kaffeemaschinen und gemurmeltem Austausch von Nichtigkeiten, unterbrochen von gelegentlichem lautem Auflachen, war für Philipp der Beleg dafür, dass die menschliche Arbeit, mit der er und seine Kolleginnen diesen Zustand hergestellt hatten, unsichtbar blieb. Gleichzeitig war es der Beweis, dass sie den heutigen Tag gut vorbereitet hatten, denn Mühsal, so hatte es ihm die marketingerfahrene Elif erklärt, darf in einer Dienstleistungsgesellschaft nach außen hin nie als Mühsal auftreten, sondern muss stets als mühelose Leichtigkeit erscheinen – als „reibungsloser Ablauf“, als Sieg der menschlichen Arbeit über die entropische Natur.
Nachdem alle Eltern Platz genommen hatten und mit Kaffee versorgt worden waren, galt es die Wartezeit bis zum Eintreffen der landespolitischen Prominenz zu überbrücken, deren gesellschaftlich höhere Stellung sich an der Länge der Verspätung bemaß, mit der moderne Machthaber sich ihrer Würde vergewisserten. Philipp betrat die Bühne, stellte sich vor das Mikrofon und räusperte sich. Das Gemurmel, Geklirre und Stuhlgeschiebe erstarb.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute bei uns bei den Stadtmäusen begrüßen zu dürfen“, sagte Philipp, dem erst jetzt, wo er auf der Bühne stand und tatsächlich zu sprechen begann, auffiel, dass der Name seines Arbeitgebers dem förmlichen Einstieg in seine vorbereitete Rede eine Wendung ins Kuriose gab, was aber vielleicht gar nicht so schlecht war, weil es die staatstragende Bedeutung des heutigen Tages ein wenig abschwächte.
Читать дальше