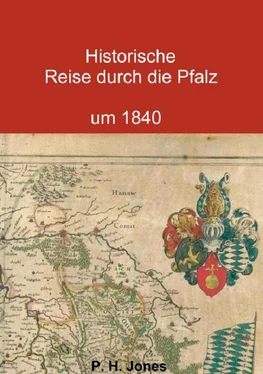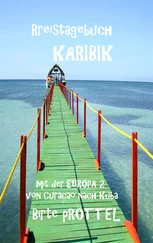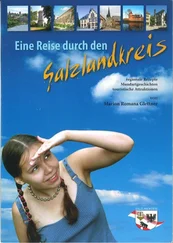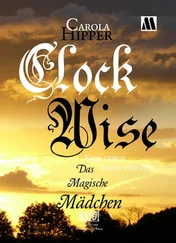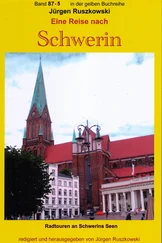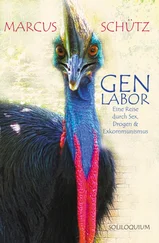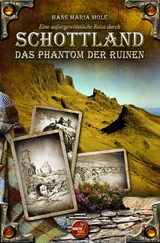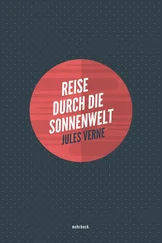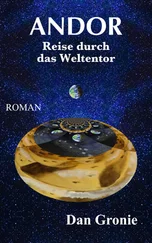P. H. Jones - Historische Reise durch die Pfalz um 1840
Здесь есть возможность читать онлайн «P. H. Jones - Historische Reise durch die Pfalz um 1840» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historische Reise durch die Pfalz um 1840
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historische Reise durch die Pfalz um 1840: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historische Reise durch die Pfalz um 1840»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Pfalz anno dazumal aus der Sicht eines Wanderers zur Zeit der Romantik. Über 760 Orte. Wie war Ihr Ort vor 200 Jahren? Erkunden sie die wild romantische Natur als noch Wölfe durch die Wälder streiften. Entdecken Sie Burgen, Römische Straßen und Ruinen, Klöster, ja ganze Dörfer die Heute gänzlich verschwunden sind.
P. H. Jones
Historische Reise durch die Pfalz um 1840 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historische Reise durch die Pfalz um 1840», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Unsere Wanderung in den nördlichen Teil des Kantons antretend, kommen wir zuerst nach dem schon auf dem Wege von Albersweiler nach Annweiler berührten Dorfe Queichhambach, mit 278 Einwohnern, am linken Ufer der Queich, das in Urkunden des Mittelalters bald Hambach , bald Hahnenbach genannt ist. Den letztern Namen hat es von dem seine Gemarkung durchfließenden Hahnenbächlein. Dieses Dorf darf aber mit dem auf der andern Seite in die Queich fallenden Hahnenbach nicht verwechselt werden. Ehemals von der Reichsvogtei zu Trifels abhängig, Fiel der Ort nachher an Zweibrücken, und gehörte zum Amte Neukastel. Im Queichhambacher Banne, zu dem die Kaisers und Neumühle gehört, lag vordem das Dorf Steinbach, welches aber längst eingegangen ist, und nur noch durch die Steinbacher Wiesen, die das Bächlein gleiches Namens bewässert, in der Erinnerung lebt. Der nächste Ort ist Grävenhausen, 700 Einwohner schon in einer Urkunde von 817 Grazelveshusen genannt, am Hahnenbach. Es gehörte im 18. Jahrhundert von adligem Hause von Metz, worauf es (1189) an das Kloster Eußertal, und später mit diesem an Kurpfalz kam. Gleiches Schicksal hatten die benachbarten Höfe Mettenbach und Rotenbach, ehedem Dörfer, aber schon zur Blütezeit des Klosters in Meiereien verwandelt. Auf den umliegenden Bergen wird ein guter roter Wein gebaut. Rechts von Grävenhausen geht der Weg nach Ramberg, einem großen Dorfe, von beinahe 12l0 Einwohnern, am Fuße des gleichnamigen Berges liegend, wo sich die Ruine des alten Schlosses Ramberg auf Felsen erhebt. Wahrscheinlich ist dasselbe von 1150 bis 1163 erbaut worden. Von dieser Zeit bis in das 16. Jahrhundert kommen Ritter Dietlieb von Ramesberg vor. Ihr Name erlosch 1520. Eine schauerliche Kunde von dieser Burg, nach welcher einst ein berüchtigter Räuber, der sich Ritter nannte, hier eingekehrt, und, um den Geldschatz des Eigentümers zu erbeuten, diesen Nachts im Schlafe durch seinen Knecht ermorden lassen wollte, letzterer aber, der das ihm bezeichnete Gemach verfehlte, in der Dunkelheit den Bösewicht selbst erstach, ist in Schreibers Volkssagen, wie auch in meinen Sagen und Geschichten des Rheinlandes, mitgeteilt. Der letzte Sprössling der Ramberger Hans, verkaufte seine Burg und Güter an die Grafen von Dalberg, welche sie aber bald darauf dem Grafen Friedrich von Löwenstein, Herrn von Scharfeneck, überließen, dessen Haus auch bis zum Revolutionskriege die Herrschaft besaß. In den Feldern des Dorfes Ramberg werden viele Kirschen gepflegt. Diese und das daraus bereitete Kirschenwasser sind ein Haupterwerbszweig der Einwohner Auch werden hier eine Menge Bürsten verfertigt und auswärts verkauft. Zu dem Orte gehört der Hof Modeck, auch Modenberg, und Modenbacher Hof genannt, der ehemals ein Dorf war. Er liegt am Modenbach, jenseits der bei der Ruine von Meistersel hinziehenden Rothsteig, und an der Modenbacher Steig, die in das Gebirge zur Hochstraße führt. Die Burg, Meistersel, deren graue Trümmer von dieser Anhöhe herabschauen, war zu Ende des 11 Jahrhunderts ein Eigentum des Bischofs Johann von Speyer, der sie seinen Nachfolgern im Hochstift vermachte. Als Lehensmänner desselben sind 1186 Ritter von Meistersel (auch Meistersal, Meisterfelden) und späterhin Ritter von Modenbach, genannt. Die letzten gehörten zu dem adlichen Geschlechte von Kopf. Im 14 Jahrhundert, wo Schloss und Dorf ein Lehen der Abtei Klingenmünster waren, befanden sich die Herren von Ochsenstein, sodann die Landschaden von Steinach, die Dalberge, etc., in deren Besitz. Endlich brachten 1662 und 1665 das gräfliche Haus von der Lehen und Kurpfalz die Oberlehnsherrschaft häuslich an sich, so das ersteres siebenachtel und letzteres einachtel davon erhielt.
Das benachbarte, ehemals Löwensteinische Dorf Derenbach, 520 Einwohner am gleichnamigen Bache, in der Bürgermeisterei und im Tale von Ramberg liegend, kommt in Urkunden des 12 Jahrhunderts als Tegerenbach und Deirenbach vor. Zu ihm gehört der Pfalzhof, auch Breitwiese genannt. Nordöstlich von diesem Orte zeigt sich auf den wilden Höhen die schöne Ruine der Burg Scharfeneck, welche aber, da sie in der Gemarkung von Flemlingen liegt, zu dem angrenzenden Kanton Edenkoben gerechnet wird. Ehedem war sie das Haupt einer unmittelbaren Herrschaft, deren Besitzer unter den hohen Adel des Reichs gehörten. Auch waren die Herren von Scharfeneck von den Kaisern mit der Feste Scharfenberg bei Trifels beliehen, und fügten darum deren Namen zu ihrer Würde. Ein Ritter aus diesem Hause verband sich in der Mitte des 13. Jahrhunderts mit einer Dame aus dem herrlichen Geschlechte von Metz, wodurch, ihm noch eine große Erbschaft zufiel, und im Jahre 1274 erscheint ein Johann von Scharfenect, der sich zugleich Herr von Metis oder Mez nannte. Nach Abgang der kurpfälzischen Erbtruchsesse, Herren von Alzey, erhielt diese Familie ihr Amt. Aber sie erlosch um das Jahr 1430 und die Herrschaft Scharfeneck kam an Kurpfalz. Friedrich der Siegreiche belehnte damit, 1477 seinen und der schönen Klara von Detten natürlichen Sohn Ludwig, von dem das gräflich und fürstliche Haus Löwenstein Werthheim abstammt. In den pfälzischen Lehnbriefen wird die Besitzung als „Herrschaft und Schloss Alt und Neu Scharfeneck in dem Gebirge des Wasgaues“ angeführt.
Nordwestlich von Grävenhausen kommt man nach Eußertal, einem Dorfe mit 800 und etlichen Einwohnern, das in einem Wiesentale, zwischen zwei steilen Bergen, und an dem Sülzbächlein liegt. Dieses, auch Gevaiden und Mühlbach genannt, entspringt, eine Stunde von hier, in der obern Haingeraide treibt im Dorf eine Mühle und fließt nach der Queich. Das Eußerstal, welches dem Ort seinen Namen verlieh, hieß im 12. Jahrhundert Uterstal (Tal des Uter's), etwas später Uzers auch Usersund Ufserstal, welches letztere Manche, wegen seiner Entlegenheit, für äußerstes Tal erklären. Aber in lateinischen Urkunden wird es Uterina Vallis und Usterinae Valles genannt, was den Grund der ersten Benennung, das vielleicht in grauer Vorzeit ein Ritter oder Einsiedel, Uter, daselbst gehauset, zu erweisen scheint. Jenes Dorf ist berühmt durch die bei ihm stehende Ruine des Zisterzienserklosters Eußerstal, welches eine Kolonie der Abtei Weiler Betnach (Metzer Diöces) war, und demnach zur Zisterzienser linte Morimund gehörte. Es ward 1148 von einem Ritter Stephan von Merlheim gestiftet, dessen Bruder Konrad ihm bereits 1l09, als er in das Kloster Hirsau trat, sein Erbteil überlassen hatte. Schon wenige Jahre nach der Gründung des Stiftes mehrten sich dessen Besitzungen, und die Anstalt gelangte nach und nach durch zahlreiche Schenkungen der Kaiser, Fürsten, Grafen und Herren zu unermesslichen Gütern und Gerechtsamen. Auch wussten sich die Mönche das Prärogativ einer Obhut der Reichskleinodien auf dem Trifels zu erwerben, welche mit großen Vorteilen verbunden war. Durch alles dies kam die Abtei in einen sehr blühenden Zustand. Allein die ganze Umgegend verarmte, weil jene das Feste an sich gebracht und am Ende Niemand mehr Grundeigentum besaß. Darum fügte sich jeder vernünftige Bewohner in die traurige Notwendigkeit, seinen Herd zu verlassen, und siedelte sich in besseren Gefilden an. So gingen mehrere Dörfer ein, und andere wurden in bloße Höfe verwandelt. Aber endlich begann auch die Unglücksperiode des Klosters. Herzog Ludwig der Schwarze von Zweibrücken kam in Fehde mit dem Kurfürsten Friedrich I von der Pfalz, der damals Schirmherr des Klosters war. Er überfiel im Jahre 1455, sodann wieder, den päpstlichen Bann nicht achtend, 1460 das Kloster, wo es starke Plünderung erlitt und das Letztem sogar in Brand gesteckt wurde. Doch ward noch, als die wilden Krieger sich entfernt, mit Hilfe dienstfertiger Einwohner der benachbarten Dörfer, die prachtvolle Kirche und Einiges von den Wohnungen vor dem Feuer gerettet, so das die Mönche in kurzer Zeit wieder ihren Sitz einnehmen konnten. Als aber im Anfange des 16 Jahrhunderts der Krieg wieder den Kurfürsten Philipp von der Pfalz, wegen der bayrischen Erbfolge, ausbrach, ließ Herzog Alexander von Zweibrücken diese Abtei abermals plündern und anzünden. Das dritte Unheil erfuhr sie im Jahre 1525 durch die aufrührerischen Bauern, welche, im Sturm hinein, dringend, raubten und verheerten, was ihnen vorkam. Auch wurden, bei den damals erfolgten Religionsveranstaltungen, die Mönche von ihren eigenen Beschützern so gedemütigt, das der größte Teil seinen Gelübde entsagte oder sich nach anderen Klöstern wandte. Endlich zog (1565) Kurfürst Friedrich III auch dieses Kloster ein, um, wie Crollius sagt: „dessen Einkünfte zu besseren Bestimmungen anzuwenden.“ Von Äbten, die ihm seit der Gründung bis zum Verfalle seiner geistlichen Macht vorgestanden, nennt Widder 17, Remling (urkundliche Geschichte der ehemaligen Abteien und Klöster) aber 3l Namen. Der erste hieß Eberhard, der (wahrscheinlich) letzte Martin II, genannt Zydel. Dieser ward 1551 erwählt, und suchte mit allem Eifer die verwüsteten Gebäude wieder herzustellen, was noch eine lesbare lateinische Inschrift an dem so genannten runden Abtturme bezeugt. Während des 30jährigen Kriegs fanden sich wieder einige Mönche hier ein und erwählten sogar einen Abt. Darauf übergab Kaiser Ferdinand II das Kloster den Jesuiten, deren Herrschaft auf diesem Boden nicht gedeihen wollte. Durch den westphälischen Frieden kam das Stift wieder an Kurpfalz, und warb den Evangelisch Reformierten neuerdings eingeräumt. Der Kurfürst überließ die Gebäude und Güter meist piemontesischen Auswanderern, wo denn allmählig das jetzige Dorf Eußertal entstand. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Franzosen in die Pfalz ein Fielen, und, auf den Grund gestützt, das vordem dieses ganze Land zum Königreich Austrosien gehört, das Oberamt Germersheim in Besitz nahmen, erhielt der Zisterzienser Abt de Poissons das hiesige Kloster, vertauschte es aber an de Crecy Bischof von Grasse, den auch eine päpstliche Bulle darin bestätigte. Allein nach dem Ryswiker Frieden (1697) Fiel es an die Pfalz zurück, und ward durch die bekannte Religionserklärung von 1705 mit allen seinen Einkünften der katholisch geistlichen Verwaltung einverleibt. Späterhin ward daselbst eine Probstei errichtet, welche man 1716 dem Domherrn Heinrich Wilhelm Freiherrn von Sickingen, kurpfälzischem Oberstkämmerer und Oberamtmann zu Bretten, übertrug, der auch bis zu seinem 1757 erfolgten Tod in ihrem Besitze war. Alsdann kam sie wieder an die genannte geistliche Verwaltung, bis die französische Revolution alle diese Wechsel beendigte. Von den Klostergebäuden sind nur einige Reste, und von der prächtigen Kirche noch das Chor, übrig. Eine steinerne Platte oberhalb der Kanzel zeigt den Namen des Stifters an. Zu dem Dorfe gehören zwei Meierhöfe, der Stockwieser, gewöhnlich Vogelstock genannt, und der Pfalzhof, welche in dem Eussers Taler Walde liegen. Dieser bildet einen Teil der großen Forstalmende, die unter dem Namen Ober Haingeraide bekannt ist.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historische Reise durch die Pfalz um 1840»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historische Reise durch die Pfalz um 1840» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historische Reise durch die Pfalz um 1840» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.