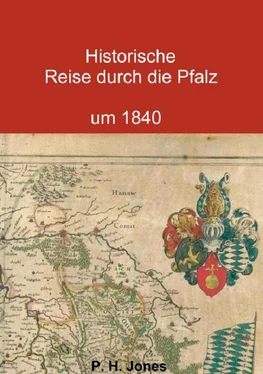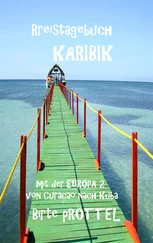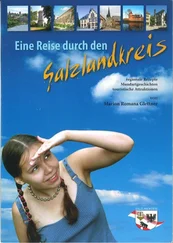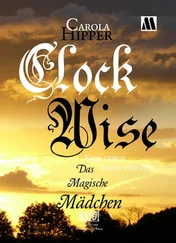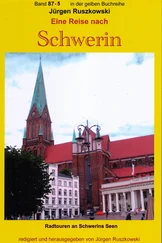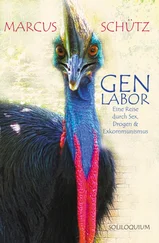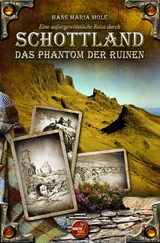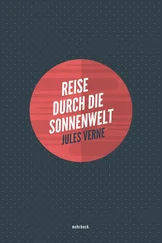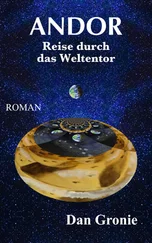P. H. Jones - Historische Reise durch die Pfalz um 1840
Здесь есть возможность читать онлайн «P. H. Jones - Historische Reise durch die Pfalz um 1840» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historische Reise durch die Pfalz um 1840
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historische Reise durch die Pfalz um 1840: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historische Reise durch die Pfalz um 1840»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Pfalz anno dazumal aus der Sicht eines Wanderers zur Zeit der Romantik. Über 760 Orte. Wie war Ihr Ort vor 200 Jahren? Erkunden sie die wild romantische Natur als noch Wölfe durch die Wälder streiften. Entdecken Sie Burgen, Römische Straßen und Ruinen, Klöster, ja ganze Dörfer die Heute gänzlich verschwunden sind.
P. H. Jones
Historische Reise durch die Pfalz um 1840 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historische Reise durch die Pfalz um 1840», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Von dem waldigen Berge, an dessen, Fuß die Überreste der ehemaligen Abtei liegen, schaut noch die Ruine der alten Burg Landeck auf den Ort herab. Ihr Ursprung verliert sich in fabelhafte Zeiten. Man findet in den mit Wahrheit und Dichtung gemischten, Altertümern des Königreichs Austrasien die Nachricht, das Landfredus, ein Stadthalter der fränkischen Könige, im Jahr 420 das Bergschloss Landfreduseck erbaut, König Dagobert I dasselbe 620 erweitert und zum königlichen Stuhl (auf dem man die Gaugerichte hielt) für diese Gegend erwählt habe. Wenn auch diese Kunde nicht historisch begründet ist, so könnte doch die Burg Landeck noch früher, als das Kloster erbaut worden sein, und letzterem nach dessen Stiftung zum Schutze gedient haben. Lag ja doch, wie wir schon anderswo, der Meinung eines berühmten Schriftstellers zufolge, bemerkten, in dem Freiheit und Natur liebenden Charakter unserer altdeutschen Vorfahren die Neigung, sich auf weit umsehenden Höhen, von grünen Wäldern, wiesenreichen Tälern und klaren Bächen umringt, anzusiedeln. Daher entstanden jene uralten Felsburgen, die man in der nachmaligen Fehdezeit zu Schutz und Trutz gebraucht und noch vermehrt hat. Der Name des gegenwärtigen Schlosses soll von seiner Lage auf der höchsten Spitze oder Ecke dieses Landes herkommen. Die geschichtliche Urkunde, welche der Burg Landhechen (später Landeggen, Lanteck und Landeck) zuerst gedenkt, ist vom Jahr 1237. Damals scheinen sie die Grafen von Zweibrücken und von Leiningen, als unmittelbares Reichslehen, gemeinschaftlich besessen zu haben. Als während des stürmischen und für Deutschland so verderblichen Zwischenreichs die Rheinischen Städte einen bewaffneten Bund zu ihrer Sicherheit und zur Aufrechthaltung des Friedens geschlossen, entbrannte hierdurch manche Fehde mit dem hohen und niedern Adel. Da geschah es auch, das der Graf Emich von Leinnigen die Gesandten dieses Bundes, welche im September 1255 von Mainz her nach Straßburg zogen, in dieser Gegend anhalten und an der Feste Landeck eine Zeit lang gesänglich verwahren ließ. Nachmals Fiel der Leiningische Anteil dieser Burgen die Herren von Ochsenstein, und das Ganze wird im 14. Jahrhundert als ein Lehn der Abtei Klingenmünster genannt. Der Zweibrückische Teil kam nachmals an Kurpfalz, der Ochsensteiner an das Bistum Speyer, welches Letztere den seinigen 1709 ebenfalls dem Kurhause gegen Tausch abtrat, so das dieses nunmehr den Besitz des gesamten, nach dem alten Schlosse benannten, Amtes erhielt. Östlich von hier liegt das Dorf Klingen (550 Einwohner), am Klingenbach, wovon im 13. Jahrhundert ein ritterliches Geschlecht benannt ist, und weiter landeinwärts gewahrt man die Dörfer Heuchelheim, mit 820, und Appenhofen, mit 270 Einwohnern am Kaiserbache, die beide in den Lorscher Urkunden vom 8. Jahrhundert, ersteres als Huglinheim und Heuchlenheim (Sitz des Hugelins), letzteres als Abbenhova (Hof des Abbo), vorkommen. Alle drei waren Kurpfälzisch.
Gleich unterhalb Klingenmünster betritt man den Kanton Landau, wo denn der weitere Weg über das Dorf Eschbach, an welchem sich auf dem Berggipfel die Ruine der Madenburg erhebt, und dann rechts durch das flachere Land, nach der Stadt Landau führt. Ehe wir jedoch den Kanton Bergzabern verlassen, sei besonders noch das beträchtliche Dorf Dörrenbach erwähnt, das, südwestlich von dem Hauptort, über, einem Bergtal und am Ursprung des Dörrenbaches gelegen ist. In der Nähe befindet sich die Kolbruunderger Kapelle mit einem Eremiten sitzend. Ein ähnliches, dem heiligen Wendelin geweihtes Kirchlein, nebst Einsiedelei, liegt oberhalb der Stadt Bergzabern. Dörrenbach ist dadurch historisch merkwürdig, das im Mittelalter hier ein Behmgericht soll gewesen sein. Der Ort zu dem eine Loh , Öl, und andere Mühlen, wie auch die so genannte Zöpfelslust Wohnung, gehören, zählt 1181 Einwohner die Feld und Wiesenbau treiben. In alten Urkunden heißt er Türrenbach. Noch übrige Orte des Kantons sind im Gebirge, Die ehemals Kurpfälzischen Dörfer Blankenborn (152 Einwohner) und Bellenborn mit Reichsdorf l290 Einwohner). Dann östlich in der Ebene Mühlhofen, 676, Oberhausen, mit einer Mühle am Erienbach, 500, Hergersweiler, 162, und Dierbach, 617 Einwohner zählend. Sämtlich vorher Zweibrückisch Ferner nach Süden Steinfeld, mit dem Weiler Klein Steinfeld, 16l2 Seelen stark und Kapsweier (1014 Einwohner), mit ersterem vor dem der Probstei Weißenburg unter französischer Hoheit gehörig.
Land Kommissariat Bergzabern
Kanton Annweiler
Dieser sehr große Kanton, welcher den von Bergzabern südlich begrenzt, unterscheidet sich von demselben wesentlich dadurch, dass man hier keine fruchtbare Ebene, sondern grössen teils raue, gebirgige und mit Waldungen bedeckte, Gegenden sind. Darum ist auch das Klima weniger mild und der Boden lange nicht so ergiebig. Kartoffeln, Gerste und Hafer sind Hauptprodukte, doch gibt es auch Stellen, wo der Weinstock ziemlich gut gedeiht und schöne Baumfrüchte, sogar etwas Kastanien, erzielt werden. Was aber den Reisenden, der ein Freund der schönen Natur und der Denkmäler des Altertums ist, in diesem Landstriche besonders anzieht, sind die malerischen, wildromantischen Täler, ihre lieblichen Wiesen, von Bächen durchströmt, die schauerlichen Felsgruppen, und die hohen steilen Gebirge, auf deren Gipfeln man die Ruinen alter Burgen erblickt, die eben so seltsam durch ihre Lage, als merkwürdig in den Geschichten und Sagen der rheinischen Vorzeit erscheinen.
Wir treten zuerst unsere Wanderung nach dem herrlichen Annweiler Tale an, wohin gewöhnlich der Weg von Landau her über Sibeldingen, an Godramstein vorbei, genommen wird. Der erste Ort des Kantons, den man auf dieser Seite betritt, ist Albersweiler, ein Marktflecken von 2160 Seelen, grössen teils protestantischer Religion. Er liegt am Eingange des Tals, und wird von der Queich durchflossen, nach welcher jenes auch das Queichtal genannt ist, indem es von hier an derselben hin und bis hinter Falkenburg sanft bergan zieht, worauf es sich wieder längs dem Horbach gegen die Wieslauter herabsenkt. Die Queich durchläuft den ganzen Kanton, nimmt rechts im Gebirge den Rinn und Ebersbach, links den vereinten Fisch und Wellbach, sodann die Sülz, auf, und teilt sich bei Albersweiler in zwei Arme, wovon der linke das eigentliche Flüsschen bleibt, der rechte aber im Jahr 1686 durch den berühmten Ingenieur Bauban, zum Behuf des Festungsbaues von Landau, als Kanal angelegt wurde, der sich bei dieser Stadt wieder mit dem Gewässer des andern vereint. Albersweiler wird in einer Urkunde von 1254 Adelbrachteswilre genannt, da ein adliches Geschlecht dieses Namens vorkommt. Später hieß der Ort Älbrechtswilre, dann Albirswilre etc., bis er endlich den gegenwärtigen Namen erhielt. In dem nahen, von Rebenhügeln eingeschlossenen, Tälchen, am Schweltenbächlein, liegt der Weiler Kanskirchen oder St. Johann, der, nebst dem Steigerthof, (welcher sich am so genannten Steigert, einem über das Gebirge nach der Burg Scharfeneck führenden Wege befindet,) der Ziegelhütte und Waffenschmiede, zur Gemeinde Albersweiler gehört, (ehemals stand die Südseite des letztern Ortes unter Zweibrücken, die Nordseite aber, nebst Kanskirchen und dem Steigerhofe, besaßen die Fürsten von Löwenstein Werthheim wegen der Herrschaft Scharfeneck. Der schon im Anfang des l3. Jahrhunderts erwähnte, Name Kanskirchen entstand aus Johanniskirch den, wie noch jetzt die dortige Kirche heißt. In diesem Örtchen bestand auch einst ein Frauenkloster. Albersweiler hat schöne Weinberge und betreibt die Kultur derselben stärker, als irgendeine Gemeinde des Kantons. Auch ist dabei ein sehr ergiebiger Granitsteinbruch. Durch den Ort geht die Straße, welche von Landau über Annweiler und Pirmasens nach Zweibrücken zieht.
Unsern Weg auf dieser Straße, an dem Ufer der Queich hin, fortsetzend, kommen wir bald nach dem Städtchen Annweiler, das eine dreiviertel Stunde von hier und 2 Stunden von Landau entfernt ist. Mit Recht wird seine malerische Lage gerühmt. Ein anmutiges Wiesenthal, durch welches der starke helle Bach, an dessen beiden Ufern der Ort erbaut ist, heranfurtet, erstreckt sich zwischen waldreichen Höhen, auf welchen hier und da die Trümmer zerfallener Burgen emporragen. In mancher wunderlichen Form erscheinen die Felsen, Kolosse des Gebirges, deren einige wie alte Schlösser, andere, in größerer Masse, wie ganze Dörfer von der Natur gestaltet sind. Diesen seltsamen Anblick hat man besonders auf dem Fußwege, der von Annweiler aus durch die wilde Gegend nach Dahn führt. Die Stadt Annweiler (ehemals Anwilre, Annewil und Anninwilir) bestand, nach Urkunden, schon im Anfange des 12. Jahrhunderts als Dorf, welches Friedrich II Herzog in Schwaben, 1116 gegen Mornsbrunn (im Elsass, an der Sur) eintauschte. (Siehe Urgeschichte des Herzogtums Zweibrücken, nach Johaunis und Crollius Kalenderarbeiten) Kaiser Friedrich I (Barbarossa), Sohn des genannten Herzogs, umgab den Ort mit Mauern, und erklärte ihn somit zur Stad. Nach Herzogs klassischer Chronik wurde ihm zugleich Friedrichs Gemahlin Anna der lateinische Name Annae Villa erteilt. Der Enkel dieses Kaisers, Friedrich II verlieh demselben sogar die Rechte und Freiheiten der Stadt Speyer. Nach Abgang des Hohen, staufischen Hauses ward Annweiler (1269) eine Reichsstadt. Aber Kaiser Ludwig IV verpfändete diese 1330 an seine Neffen, die Pfalzgrafen. Jedoch mit Bestätigung ihrer Reichsfreiheiten, und endlich kam sie ganz in Besitz des Pfalzgräflichen Hauses, und namentlich der Herzöge von Zweibrücken, als eine zu dem Oberamte Bergzabern gehörigen Stadtschultheiserei, bis sie in neuerer Zeit das wechselnde Los der ganzen Gegend teilte. Dermalen ist Annweiler der Hauptort des Kantons, und es befinden sich hier ein Friedensgericht, zwei Notariate, eine Gendarmerie Station, ein Physikat, ein Rentamt und ein Forstamt, zu welchem letztern 5 Revierförstereien im Kanton gehören. Die Stadt, nebst dem Dorfe Sarnstal, mit welchem sie eine Gemeinde bildet, der Minken und Michelischen Papiermühle , zählt 2602, meist protestantische, Einwohner Weinbau, starke Obstpflanzung und Viehzucht, welche die grasreichen Täler sehr begünstigen, sind Haupterwerbzweige. Auch wird hier Holzhandel getrieben, und Leder, Papier und Kirschenwasser verfertigt. Der beste Gasthof ist der zum Trifels. Das genannte Dorf Sarnstal (von einigen auch Sarnstall geschrieben) liegt unweit der Stadt am Queichflusse. Professor Crollius konnte von ihm keine Nachrichten vor dem 15. Jahrhundert auffinden. Beide Konfessionen in Annweiler haben Pfarreien, mit der katholischen ist zugleich eine Schulinspektion vereint.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historische Reise durch die Pfalz um 1840»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historische Reise durch die Pfalz um 1840» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historische Reise durch die Pfalz um 1840» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.