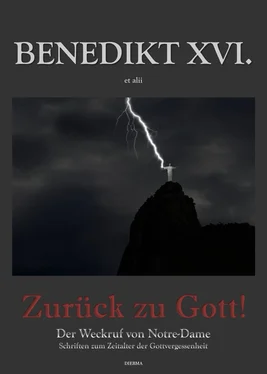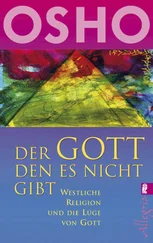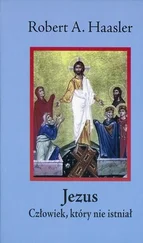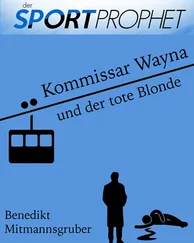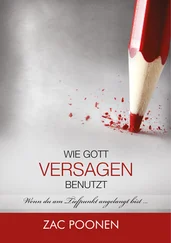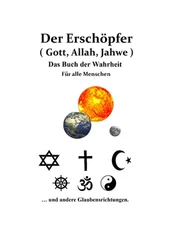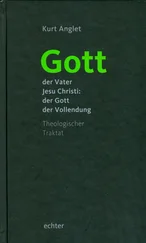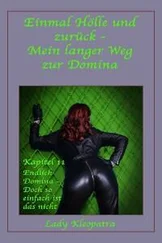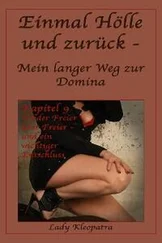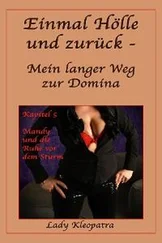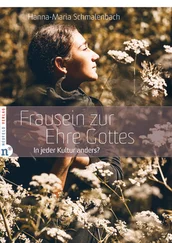Schließlich hat sich dann weitgehend die These durchgesetzt, dass Moral allein von den Zwecken des menschlichen Handelns her zu bestimmen sei. Der alte Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« wurde zwar nicht in dieser groben Form bestätigt, aber seine Denkform war bestimmend geworden. So konnte es nun auch nichts schlechthin Gutes und ebensowenig etwas immer Böses geben, sondern nur relative Wertungen. Es gab nicht mehr das Gute, sondern nur noch das relativ, im Augenblick und von den Umständen abhängige Bessere.
Die Krise der Begründung und Darstellung der katholischen Moral erreichte in den ausgehenden 80er und in den 90er Jahren dramatische Formen. Am 5. Januar 1989 erschien die von 15 katholischen Theologie-Professoren unterzeichnete »Kölner Erklärung«, die verschiedene Krisenpunkte im Verhältnis zwischen bischöflichem Lehramt und der Aufgabe der Theologie im Auge hatte. Dieser Text, der zunächst nicht über das übliche Maß von Protesten hinausging, wuchs ganz schnell zu einem Aufschrei gegen das kirchliche Lehramt an und sammelte das Protestpotential laut sicht- und hörbar, das sich weltweit gegen die zu erwartenden Lehrtexte von Johannes Paul II. erhob (vgl. D. Mieth, Kölner Erklärung, LThK, VI3, 196).
Papst Johannes Paul II., der die Situation der Moraltheologie sehr gut kannte und sie mit Aufmerksamkeit verfolgte, ließ nun mit der Arbeit an einer Enzyklika beginnen, die diese Dinge wieder zurechtrücken sollte. Sie ist unter dem Titel »Veritatis splendor« am 6. August 1993 erschienen und hat heftige Gegenreaktionen von Seiten der Moraltheologen bewirkt. Vorher schon war es der »Katechismus der katholischen Kirche«, der in überzeugender Weise die von der Kirche verkündete Moral systematisch darstellte.
Unvergessen bleibt mir, wie der damals führende deutsche Moraltheologe Franz Böckle, nach seiner Emeritierung in seine Schweizer Heimat zurückgekehrt, im Blick auf die möglichen Entscheidungen der Enzyklika »Veritatis splendor« erklärte, wenn die Enzyklika entscheiden sollte, dass es Handlungen gebe, die immer und unter allen Umständen als schlecht einzustufen seien, wolle er dagegen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften seine Stimme erheben. Der gütige Gott hat ihm die Ausführung dieses Entschlusses erspart; Böckle starb am 8. Juli 1991. Die Enzyklika wurde am 6. August 1993 veröffentlicht und enthielt in der Tat die Entscheidung, dass es Handlungen gebe, die nie gut werden können. Der Papst war sich des Gewichts dieser Entscheidung in seiner Stunde voll bewusst und hatte gerade für diesen Teil seines Schreibens noch einmal erste Spezialisten befragt, die an sich nicht an der Redaktion der Enzyklika teilnahmen. Er konnte und durfte keinen Zweifel daran lassen, dass die Moral der Güterabwägung eine letzte Grenze respektieren muss. Es gibt Güter, die nie zur Abwägung stehen. Es gibt Werte, die nie um eines noch höheren Wertes wegen preisgegeben werden dürfen und die auch über dem Erhalt des physischen Lebens stehen. Es gibt das Martyrium. Gott ist mehr, auch als das physische Überleben. Ein Leben, das durch die Leugnung Gottes erkauft wäre, ein Leben, das auf einer letzten Lüge beruht, ist ein Unleben. Das Martyrium ist eine Grundkategorie der christlichen Existenz. Dass es in der von Böckle und von vielen anderen vertretenen Theorie im Grunde nicht mehr moralisch nötig ist, zeigt, dass hier das Wesen des Christentums selbst auf dem Spiel steht.
In der Moraltheologie war freilich inzwischen eine andere Fragestellung dringend geworden: Es setzte sich weithin die These durch, dass dem kirchlichen Lehramt nur in eigentlichen Glaubensfragen endgültige Kompetenz (»Unfehlbarkeit«) zukommt, Fragen der Moral könnten nicht Gegenstand unfehlbarer Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes werden. An dieser These ist wohl Richtiges, das weiter diskutiert zu werden verdient. Aber es gibt ein Minimum morale, das mit der Grundentscheidung des Glaubens unlöslich verknüpft ist und das verteidigt werden muss, wenn man Glauben nicht auf eine Theorie reduzieren will, sondern in seinem Anspruch an das konkrete Leben anerkennt. Aus alledem wird sichtbar, wie grundsätzlich die Autorität der Kirche in Sachen Moral zur Frage steht. Wer der Kirche in diesem Bereich eine letzte Lehrkompetenz abspricht, zwingt sie zu einem Schweigen gerade da, wo es sich um die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge handelt.
Unabhängig von dieser Frage wurde in weiten Kreisen der Moraltheologie die These entwickelt, dass die Kirche keine eigene Moral hat und haben kann. Dabei wird darauf hingewiesen, dass alle moralischen Thesen auch Parallelen in den übrigen Religionen kennen würden und ein christliches Proprium daher nicht existieren könne. Aber die Frage nach dem Proprium einer biblischen Moral wird nicht dadurch beantwortet, dass man zu jedem einzelnen Satz irgendwo auch eine Parallele in anderen Religionen finden kann. Vielmehr geht es um das Ganze der biblischen Moral, das als solches neu und anders ist gegenüber den einzelnen Teilen. Die Morallehre der Heiligen Schrift hat ihre Besonderheit letztlich in ihrer Verankerung im Gottesbild, im Glauben an den einen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt und der als Mensch gelebt hat. Der Dekalog ist eine Anwendung des biblischen Gottesglaubens auf das menschliche Leben. Gottesbild und Moral gehören zusammen und ergeben so das besondere Neue der christlichen Einstellung zur Welt und zum menschlichen Leben. Im übrigen ist das Christentum von Anfang an mit dem Wort hodós beschrieben worden. Der Glaube ist ein Weg, eine Weise zu leben. In der alten Kirche wurde das Katechumenat gegenüber einer immer mehr demoralisierten Kultur als Lebensraum geschaffen, in dem das Besondere und Neue der christlichen Weise zu leben eingeübt wurde und zugleich geschützt war gegenüber der allgemeinen Lebensweise. Ich denke, dass auch heute so etwas wie katechumenale Gemeinschaften notwendig sind, damit überhaupt christliches Leben in seiner Eigenart sich behaupten kann.
II. Erste kirchliche Reaktionen
1.
Der lang vorbereitete und im Gang befindliche Auflösungsprozess der christlichen Auffassung von Moral hat, wie ich zu zeigen versuchte, in den 60er Jahren eine Radikalität erlebt, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Diese Auflösung der moralischen Lehrautorität der Kirche musste sich notwendig auch auf ihre verschiedenen Lebensräume auswirken. In dem Zusammenhang des Treffens der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt mit Papst Franziskus, interessiert vor allem die Frage des priesterlichen Lebens, zudem die der Priesterseminare. Bei dem Problem der Vorbereitung zum priesterlichen Dienst in den Seminaren ist in der Tat ein weitgehender Zusammenbruch der bisherigen Form dieser Vorbereitung festzustellen.
In verschiedenen Priesterseminaren bildeten sich homosexuelle Clubs, die mehr oder weniger offen agierten und das Klima in den Seminaren deutlich veränderten. In einem Seminar in Süddeutschland lebten Priesteramtskandidaten und Kandidaten für das Laienamt des Pastoralreferenten zusammen. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten waren Seminaristen, verheiratete Pastoralreferenten zum Teil mit Frau und Kind und vereinzelt Pastoralreferenten mit ihren Freundinnen zusammen. Das Klima im Seminar konnte die Vorbereitung auf den Priesterberuf nicht unterstützen. Der Heilige Stuhl wusste um solche Probleme, ohne genau darüber informiert zu sein. Als ein erster Schritt wurde eine Apostolische Visitation in den Seminaren der U.S.A. angeordnet.
Da nach dem II. Vaticanum auch die Kriterien für Auswahl und Ernennung der Bischöfe geändert worden waren, war auch das Verhältnis der Bischöfe zu ihren Seminaren sehr unterschiedlich. Als Kriterium für die Ernennung neuer Bischöfe wurde nun vor allen Dingen ihre »Konziliarität« angesehen, worunter freilich sehr Verschiedenes verstanden werden konnte. In der Tat wurde konziliare Gesinnung in vielen Teilen der Kirche als eine der bisherigen Tradition gegenüber kritische oder negative Haltung verstanden, die nun durch ein neues, radikal offenes Verhältnis zur Welt ersetzt werden sollte. Ein Bischof, der vorher Regens gewesen war, hatte den Seminaristen Pornofilme vorführen lassen, angeblich mit der Absicht, sie so widerstandsfähig gegen ein glaubenswidriges Verhalten zu machen. Es gab – nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika – einzelne Bischöfe, die die katholische Tradition insgesamt ablehnten und in ihren Bistümern eine Art von neuer moderner »Katholizität« auszubilden trachteten. Vielleicht ist es erwähnenswert, dass in nicht wenigen Seminaren Studenten, die beim Lesen meiner Bücher ertappt wurden, als nicht geeignet zum Priestertum angesehen wurden. Meine Bücher wurden wie schlechte Literatur verborgen und nur gleichsam unter der Bank gelesen.
Читать дальше