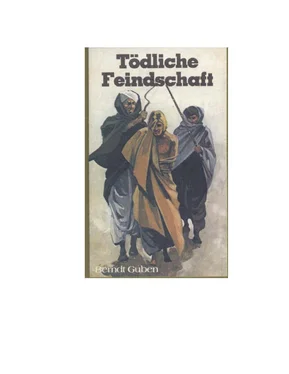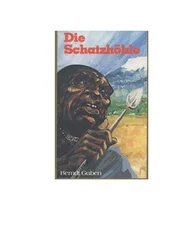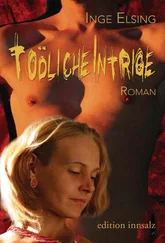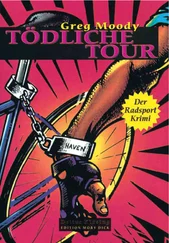René lachte. »Nun, meine Mannschaft ist noch die alte, nämlich bestehend aus meinen Vettern, Verwandten und sonstigen Kavalieren. Wenn Ihr Vertrauen zu mir habt, so würde ich mich heute gern für Eure damalige Freundlichkeit revanchieren und Euch Passage anbieten. Allerdings muß ich Euch darauf aufmerksam machen, daß ich zuerst nach Hamburg gehen muß. Es wird also einen kleinen Umweg geben.«
Michel konnte es kaum fassen.
»Es ist zwar unwahrscheinlich«, sagte er, »aber diesmal bin ich fast gezwungen, alles als eine Fügung anzusehen. Stellt Euch vor, ich hatte den Plan, einen Abstecher nach Hamburg zu machen, um dann nach Amerika zu gehen.«
René bestellte einen neuen Krug Wein.
»Das muß begossen werden, Messieurs.«
Sie tranken noch lange zusammen. Später meinte Michel:
»Was ist eigentlich aus der Dame geworden, die Ihr damals an Bord hattet?«
»Ihr meint Ellen-Rose?«
»Ich glaube, so hieß sie.«
»Nun, sie ist meine Frau. Diesmal habe ich sie nicht mit auf Fahrt genommen. Es sah anfangs zu gefährlich aus. Sie wohnt in Providence. Wir haben dort ein hübsches Haus am Meer.«
»Dann kann ich Euch nur beglückwünschen.«
Und nach einer Pause: »Wann gedenkt Ihr in See zu gehen, Monsieur?«
»Übermorgen früh.«
»Großartig«, sagte Michel. Und Ojo schloß sich begeistert an.
Kurz bevor sie auseinandergingen, meinte Michel noch :
»Hört, Monsieur de Mounsier, ich hätte eine großeBitte. Habe da einen guten Freund, einen Neger allerdings. Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr ihn irgendwo auf dem Schiff unterbringen könntet.«
»Ausgezeichnet«, rief Dieuxdonné. »Mein Smutje ist schon die ganze Zeit auf einen schwarzen Küchengehilfen scharf. Allerdings eins, verträgt er ein anständiges Glas Rum? Leute, die nicht trinken, kann unser Koch nicht ausstehen.«
»Oh, was das anbelangt, so kann mein Freund in jede Konkurrenz eintreten.«
»Nun, dann wären ja alle Dinge geklärt. Also denn, findet euch übermorgen früh an Bord ein.
Mit all euren Sachen. Auf gute Fahrt in die weite See, Messieurs !«
21
Blau lag der Sommerhimmel über der Residenzstadt des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel.
Vor einem kleinen Tabakladen in der Altstadt saß in der mittäglichen Stille des Gäßchens ein alter Mann auf einer Bank. Hin und wieder blinzelte er mit trüben Augen durch die Qualmwolken, die er seiner langen Pfeife entlockte, die Sonne an, so, als wollte er sich davon überzeugen, daß sie noch schien. Um diese Stunde — es mochte etwa halb zwei Uhr nachmittags sein — war er weit und breit der einzige Mensch, der zu sehen war.
Jeden Mittag saß der alte Mann hier, soweit es das Wetter erlaubte. In der Altstadt war er eine bekannte Erscheinung, und niemand stieß sich daran, daß er zur Mittagszeit, wenn die anderen Bürger entweder die Mahlzeit zu sich nahmen oder auf dem Sofa ein Nickerchen hielten, auf jener Bank vor seinem Laden in der Sonne saß.
In diesen Zeiten war das Tabakrauchen noch nicht sehr weit verbreitet. Ein Pfeife rauchender Mann auf der Straße war eine ungewöhnliche Erscheinung.
Nun, in den Augen der umwohnenden Bürger war jener alte Mann ein Original. Damals, es mochte fast ein Jahrzehnt darüber verstrichen sein, als sein Sohn plötzlich verschwunden war, war er etwas wunderlich geworden. Eigentlich war er der Typ eines Einsiedlers. Er sprach nicht viel, hielt kaum einen Schwatz; war aber auch nicht mürrisch, sondern behandelte die Leute, die ihm höflich entgegenkamen, ebenso höflich. Zudem war noch nie ein Raucher enttäuscht worden, wenn er von ihm Tabak bezog.
Es galt schon als eine Marotte, daß er einen Laden besaß, in dem man nichts als Tabak kaufen konnte. Da er jedoch nach der Meinung der Bürgerschaft durch den ausschließlichen Umgang mit dieser Ware eine spezielle Kennerschaft der Herbae sanctae [1] Herba sancta, lat. — heiliges Kraut
erworben hatte, verließ man sich auf seinen Ratschlag in der Auswahl der Sorte und deckte den Bedarf fast ausschließlich bei dem wunderlichen Alten. Und da ihm auch die benachbarten Kaufleute wegen seines gütigen Wesens gewogen waren — er war für sie nicht eigentlich ein Konkurrent —, vermieden sie es anständigerweise, neben ihren Waren auch noch Tabak feilzuhalten.
So kam es, daß der alte Andreas Baum in der Kasseler Altstadt so etwas wie ein Tabaksmonopol innehatte.
Als zwei Schläge der Glocke der Sankt Martinskirche verkündeten, daß es zwei Uhr war, kam ein schönes, nicht mehr ganz junges Mädchen die Straße herunter und setzte sich neben den Alten auf die Bank. Sollten die anliegenden Bewohner wegen eines zu tiefen Mittagsschlafs jemals die zwei dumpfen Glockenschläge von der Sankt Martinskirche überhören, so konnten sie bei schönem Wetter ihre Uhren nach dem Erscheinen des Mädchens stellen. Jeder kannte es, jeder wußte, daß es pünktlich erscheinen würde. Das Mädchen gehörte ebenso zu dem mittäglichen Bild der Straße wie der Alte. Kaum jemand nahm Notiz von ihm. Man hatte sich im Lauf der Jahre daran gewöhnt und den Grund, warum das so war, längst vergessen.
Das Mädchen, das etwa achtundzwanzig Jahre alt sein mochte, hatte, wie nur wenige Frauen auf der Welt, nicht eine einzige Freundin oder Feindin, die es beneidete. Es war nicht verheiratet und schien trotz seiner Schönheit keinen Blick für Männer zu haben. Die einzige Ausnahme bildete eben jener alte Andreas Baum, der jedoch längst ihr Großvater hätte sein können.
»Nun, Vater Baum, hat Euch die Sonne schön durchgewärmt?« fragte sie.
Der Alte blickte sie an und lächelte. Dann nickte er vor sich hin.
Langsam nahm er die Pfeife aus dem Mund und antwortete :
»Ja, ja, die liebe Sonne, diese Lebensspenderin, wenn wir sie nicht hätten!«
Sie blieben eine Weile still nebeneinander sitzen, bis das Mädchen sagte :
»Gebt mir ein Paketchen Tabak für den Vater.«
»Schon wieder?« wunderte sich der Alte. »Du hast doch erst am Montag eins gekauft.«
»Ja, ja, Papa raucht in der letzten Zeit sehr viel.«
Der Alte erhob sich langsam, zog einen Schlüssel heraus, steckte ihn umständlich in das Schlüsselloch der Ladentür und betrat das Lädchen. Das Mädchen folgte.
Der Alte öffnete eine der vielen tönernen Dosen, fuhr mit einer kleinen, blinkenden Schaufel hinein, brachte sie gefüllt wieder zum Vorschein und schüttete ein Häufchen des goldgelben Krautes auf eine Waage. Dann ergriff er ein schönes, buntes Tütchen, tat den Tabak hinein und gab es dem Mädchen.
»Sag deinem Vater, Charlotte, daß er ihn mit Verstand rauchen soll. Ich habe eine neue Mischung hergestellt. Mir schmeckt sie ausgezeichnet.«
»Danke, Vater Baum, ich will es ausrichten.«
An sich hätte es dem normalen Verlauf des Tages entsprochen, wenn sich Charlotte jetzt entfernt hätte. Der Alte sah sie sinnend an, als sie zögernd stehen blieb.
»Na, mein Kind, hast du Sorgen?«
Charlotte schien sich noch immer nicht entschließen zu können, zu sagen, was sie wollte. Doch der alte Andreas Baum war der einzige Mensch auf der Welt, dem sie restloses Vertrauen schenkte. So seufzte sie denn endlich:
»Eberstein ist wieder im Lande, Vater Baum Er sprach gleich heute vormittag bei Papa vor und bat ihn, mir die Erlaubnis zu geben, mit ihm ausreiten zu dürfen.«
Der Alte wackelte mit dem Kopf.
»Kind, Kind, magst du ihn denn gar nicht leiden? Wie viele Jahre soll das noch so gehen?
Einmal mußt du doch daran denken, einen Mann zu bekommen!«
»Ich kann ihn nicht heiraten.«
Charlottes Stimme klang leidenschaftlich. Ihre Augen schienen Blitze zu sprühen. Das ganze Mädchen war verwandelt. »Ich heirate niemanden, den ich nicht lieben kann. Immer, wenn ich ihn sehe, muß ich daran denken, daß ihn allein die Schuld an Michels Schicksal trifft. Erinnert Euch doch nur, mit welcher Genugtuung er uns von Michels Tod erzählt hat! Glaubt mir, Vater Baum, Graf Eberstein ist schlecht durch und durch. Und ich bin der festen Überzeugung, daß er nicht nur um meine Hand anhält, weil ihm keine andere gefällt, sondern um mit dieser Heirat sein eigenes Selbstgefühl zu stärken. Das, was er vor nunmehr einem Jahrzehnt begonnen hat, will er durch die Hochzeit mit mir krönen. Immer, wenn ich ihn anschaue, sehe ich die aufgeplatzte Wange, die er damals von Michels Stockhieb davongetragen hat. Nein, ich mag ihn nicht.«
Читать дальше