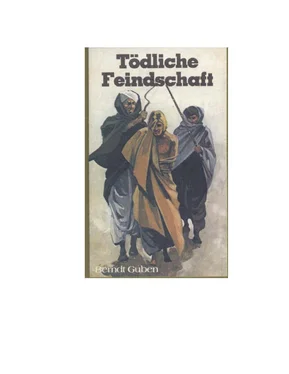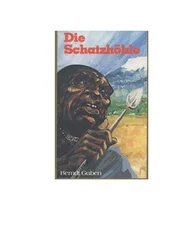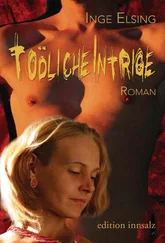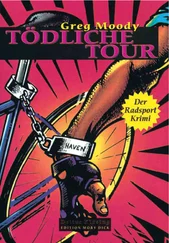»Aber wir um so mehr mit dir.«
»Was wollt ihr von mir?«
»Dich für deine Frechheit strafen.«
»Mich — für — mei — meine Frechheit strafen? Wißt ihr nicht, wer ich bin?«
»Ein Lümmel. Ein niederträchtiger Bursche, ein Gauner, der friedlich schlummernde Leute überfällt und sie wegschleppt, als wären sie sein Eigentum.«
»Was meinst du?«
»Stell dich nicht so dumm! Du weißt ganz genau, von wem wir reden.«
»Doch nicht etwa von dieser schwarzen Bestie?«
»Nimm deine Zunge in acht«, warnte ihn Michel scharf.»Wir werden dich lehren, die Freiheit anderer zu achten. Ich hoffe, daß du schwimmen kannst.«
»Ihr wollt mir wirklich etwas tun, weil ich mir diesen Neger in den Palast geholt habe?«
In der Stimme Omars schwang mehr Verwunderung als Angst mit. Er konnte es nicht begreifen, daß sich Weiße zum Anwalt eines Schwarzen machten. Für sein von Vorurteilen belastetes Gehirn war diese Tatsache unfaßlich.
»Schwarze sind Menschen wie du und ich. Merk dir das. Aber damit du es nicht vergißt, wollen wir dir ein hübsches Bad bereiten, in dem du deine schwarze Seele sauber baden kannst. Da hinten ist ein Teich.«
»Wollt ihr mich etwa ertränken?«
Michel und Ojo hatten sich von Ugawambi erzählen lassen, daß der Teich keineswegs so tief war, daß ein Mensch, selbst wenn er nicht schwimmen konnte, darin umkommen würde. So sagte Michel denn zu Ojo:
»Faß an, Diaz. Wir tun, wie ich gesagt habe.«
Omar schrie aus Leibeskräften, als er sich emporgehoben fühlte. Aber hier hörte ihn niemand. Es waren nur wenige Schritte, bis sie den Teich erreichten.
»So«, sagte Michel noch einmal, »bevor du dich in Zukunft wieder an wehrlosen Menschen vergreifst, denke an dieses Bad. Vielleicht überlegst du es dir dann vorher und entgehst der Strafe Allahs. — Achtung, Diaz, eins -zwei — drei — hau — ruck!«
Ein Schrei, ein Plumps und ein Gurgeln zeigte ihnen, daß der vornehme Emir, dem eine Katze mehr bedeutete als ein dunkelhäutiger Mensch, im feuchten Element gelandet war. Die beiden beobachteten diese Szene noch eine Zeitlang. Aber bald darauf kam der turbanbewehrte Kopf des Emir wieder zum Vorschein. Er hatte Grund unter den Füßen. Das Wasser reichte ihm gerade bis zur Brust. Aber er schrie, als stecke er am Spieß. Sie ließen ihn schreien, wandten sich ab und gingen davon.
Bald befand sich Emir Ben Sedelik wieder auf dem Trockenen. Er schüttelte sich wie ein Pudel, wurde aber davon nicht trocken. Drohend ballte er die Fäuste in der Richtung, in der Michel und Ojo verschwunden waren.
»Rache, Rache«, stammelten seine Lippen. Aber da schlugen seine Zähne aufeinander. Die Nachtluft machte die nassen Kleider zu Eistüchern. Omar Ben Sedelik erstarb das Rachegeschrei auf den blau werdenden Lippen. So schnell ihn seine Füße trugen, eilte er davon und erreichte eine halbe Stunde später den Palast. Ohne ein Wort zu sagen, trat er durch das Hauptportal ein, rannte wie gehetzt durch den langen Säulengang, bis er in das Schlafzimmer kam, entkleidete sich dort ohne Hilfe eines Dieners mit fliegenden Fingern und schlüpfte unter die seidenen Decken des Schlafdiwans. Das Bad hatte ihn so mitgenommen, daß er vor dem Einschlafen vergaß, einen fürchterlichen Schwur beim Barte des Propheten zu leisten, diese Schmach zu rächen.
Als er später einmal über dieses Erlebnis nachdachte, war er froh, diesen Schwur nicht getan zu haben; denn er hätte ihn nie halten können.
20
Michel und Ojo schlenderten durch die nächtlichen Straßen.
»Der Empfangschef des Hauses hat ein saures Gesicht gemacht, als ich ihm mitteilte, daß Ugawambi unser neuer Diener sei und im Hotel schlafen würde.«
»Laß ihn«, sagte Michel, »er hat seine Vorschriften. Wir werden Ugawambi morgen anständig einkleiden. Wenn ich nur wüßte, wo ich ihm eine gute Heuer verschaffen könnte! Ich möchte den Armen nun auch nicht gerade auf jedes x-beliebige Schiff schicken. Ich muß schon sicher sein, daß der Kapitän und die Offiziere Verständnis für seine Schwächen haben. Er ist ein guter Kerl. Man soll ihn nicht entgelten lassen, was durch die Schuld unserer eigenen Rassegenossen in ihm entstanden ist.«
»Und was wird nun mit uns?« fragte Ojo. »Wie lange wird es noch dauern, bis Ihr das richtige Schiff gefunden habt? Nehmen wir doch eins, das uns nach Portugal bringt. Meine alte Mutter lebt noch in Spanien. Bei ihr wären fürs erste unsere Steine auch sicher.«
»Hm«, brummte Michel. Sonst sagte er nichts.
»Ich verstehe überhaupt nicht recht, Señor Doktor, weshalb Ihr unbedingt in Euer Heimatland zurückwollt. All die Jahre hindurch spracht Ihr stets von Amerika. Habt Ihr Eure Pläne gänzlich geändert?«
»Durchaus nicht. Meine Sehnsucht gilt nach wie vor diesem Land der Freiheit.«
»Na, warum dann nicht gleich von hier aus dorthin?«
»Eigentlich hast du recht«, sagte Michel, »es wäre vielleicht das beste.«
»Finde ich auch; denn was wollt Ihr in Deutschland?«
»Tja«, lächelte Michel, »das —, das weiß ich auch noch nicht so recht. Es ist eigentlich nur ein Gefühl, das mich treibt. Aber was wissen wir schon von unseren Gefühlen?«
Sie kamen an einer spanischen Kneipe vorbei. Ojo warf sehnsüchtige Blicke auf den Tonkrug, der über der Tür hing.
»Hättet Ihr etwas dagegen, Señor Doktor, wenn ich noch einen Becher Wein trinken würde?«
»Keineswegs, amigo. Ich trinke sogar mit, wenn es dir recht ist.«
Sie traten über die Schwelle. Dichter Tabaksqualm schlug ihnen entgegen. Ojo hielt Umschau nach einem Tisch. Er entdeckte einen, an dem nur ein einzelner Mann saß. Sie steuerten auf diesen zu.
»Dürfen wir uns zu Euch setzen, Señor?« fragte Michel.
Der einsame Gast, der bisher in seinen Weinkrug gestarrt hatte, hob mit einem Ruck die Augen.
Groß und dunkel waren sie auf Michel gerichtet. Um seine Lippen, die oberhalb des Mundes von einem schmalen Bärtchen geziert waren, zuckte ein verhaltenes Lächeln. Plötzlich sprang er auf und hieb mit der Faust auf den Tisch, daß die Weinbecher tanzten.
»Diable«, rief er französisch, »ich will die Masten meines Schiffes zerhacken, wenn Ihr nicht Monsieur Baum seid.«
Michel und Ojo waren sprachlos. Dann reichte der Pfeifer die Hand hinüber. Der Franzose schüttelte sie kräftig.
»Ich freue mich wirklich, Monsieur, Euch einmal wiederzutreffen. Hätte es nie für möglich gehalten. Nehmt Platz, nehmt Platz, seid willkommen.«
»Klein ist die Welt, Monsieur Mounsier.«
Ja, es war der große Pirat Dieuxdonné.
Nach dem üblichen Woher und Wohin fragte Michel:
»Macht Ihr noch immer Jagd auf van Groot?«
Dieuxdonné lächelte:
»Nicht mehr nötig, Monsieur, van Groot ist pleite. Kein Hund nimmt mehr ein Stück Brot von ihm.«
»Dann hat das Seeräuberleben also ein Ende?«
Dieuxdonné, der mit seinem richtigen Namen René de Mounsier hieß, machte ein geheimnisvolles Gesicht.
»Wie man es nimmt, Monsieur«, flüsterte er. »Heute fahre ich mit einem Kaperbrief. Das heißt, ich muß mich mehr vorsehen, daß ich nicht selbst gekapert werde.«
»Wahrhaftig, sehr geheimnisvoll«, sagte Michel.
René nickte.
»Ja, ich fahre für den Präsidenten Washington. Bin Blockadebrecher für die Vereinigten Staaten geworden. Mein Bruder auch. Bin froh, daß ich wenigstens noch zu etwas nutze bin.«
»Und Euer Schiff liegt hier im Hafen?«
»Oui, bin heute nachmittag eingelaufen.«
»Euch hat das Schicksal uns in den Weg geführt«, sagte Michel. »Ich mache sonst nicht so große Worte. Aber, glaubt mir, wir suchen schon seit Tagen nach einem Schiff, das uns mitnehmen würde. Wir können aber nicht jedes Schiff nehmen, da wir einige Dinge mit uns führen, die auch die ehrlichsten Menschen zu Dieben oder gar zu Mördern machen könnten.«
Читать дальше