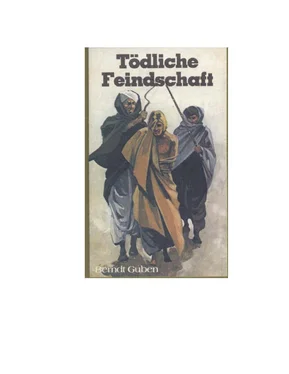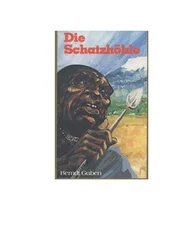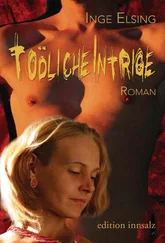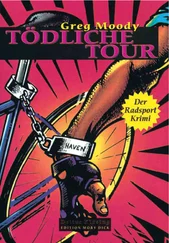Der Weg schien sie auf die buschbestande Weidefläche hinauszuführen, in die die Gasse auslief.
»Eigenartig«, murmelte Michel.
»Meint Ihr, daß das Räuber sind, Señor Doktor?«
»Das werden wir gleich feststellen. Es ist das gleiche Gelichter, wie es Imi Bejs Sklavenjäger waren. Ich müßte mich doch sehr täuschen, wenn nicht...«
Sie waren mittlerweile bei Ugawambis Hütte angelangt. Michel trat ohne Umstände ein. Es waren nur die beiden Frauen anwesend.
»Wo Ugawambi?« fragte Michel auf Kisuaheli.
Ugawambis Frau öffnete den Mund, um Auskunft zu geben. Aber da sah Michel, wie ihr die Mutter einen unsanften Stoß versetzte. Die Augen der Alten funkelten dieTochter an. Dann schnatterte ihr Mund und brachte die Wörter mit solcher Geschwindigkeit hervor, daß Michel kaum eins verstehen konnte. Dennoch schnappte er etwas auf.
»Nicht — — sagen — — Ugawambi — — Geld.«
Das war nicht viel. Aber Michel konnte sich einen Reim darauf machen; denn schließlich war er über die internen Angelegenheiten der Ugawambi-Familie orientiert. Ohne sich aufzuhalten, wandte er sich wieder zum Gehen.
»Los« , sagte er draußen zu Ojo, »folgen wir den Kerlen. Aber unauffällig. Wahrscheinlich liegt Ugawambi betrunken an seinem Lieblingsplatz.«
Die Männer vor ihnen schlenderten wie Spaziergänger auf die freie Weide hinaus. Michel und Ojo drückten sich in den Schatten der Hüttenwände. Als sie das Ende der Gasse erreicht hatten, gelangten sie ungesehen in die Dek-kung eines sich langhinziehenden Gebüsches. Einige hundert Schritt weiter hinten war diese Buschgruppe links und rechts von anderen Büschen flankiert. Und hinter einem der Sträucher auf der linken Seite war Ugawambis Lieblingsplatz.
Hier schlief er für gewöhnlich seinen Rausch aus.
Ojo wollte etwas fragen; aber Michel preßte den Zeigefinger gegen die Lippen. In der Einsamkeit hier konnte auch ein Flüstern zum Verräter werden.
Die acht Gestalten mit dem Araber an der Spitze schwärmten ein wenig aus. Aber sie hatten keine große Mühe, Ugawambi zu finden. Er lag im Schatten an seinem Stammplatz und schlief den Schlaf des besinnungslos Betrunkenen.
»Sayd«, sagte der, der ihn zuerst erblickte, in respektvollem Ton zu dem Gutgekleideten, »hier ist er.«
Schnell versammelte sich die Gruppe um den am Boden Liegenden. Michel und Ojo standen, durch das lange Gebüsch gedeckt, kaum zwei Schritte hinter ihnen.
Der mit Sayd Angesprochene trat würdevoll herzu. Aufmerksam betrachteten seine Augen Ugawambi.
»Bei Allah«, sagte er, »er ist«s.«
»Sollen wir ihn wecken, Sayd?«
»Versucht es. Wir müssen Klarheit darüber erhalten, was Imi Bej erreicht hat und wann er zurückkehren wird.«
Die acht Untergebenen des Mannes versuchten eifrig, Ugawambi den Geistern des Alkohols zu entreißen. Aber was sie auch anstellten, alles vergebens. Immer, wenn sie den armen Schwarzen unsanft hochgerüttelt hatten, sank dieser wieder in sich zusammen und schlief weiter. Eine leere Whiskyflasche lag neben ihm.
»Es hat keinen Zweck, Sayd. Allah hat ihn vergiftet. Es wird Stunden dauern, bis der Schejtan seinen Körper verläßt.«
Der Vornehme dachte nach. Dann erhellten sich seine Züge.
»Nehmen wir ihn einfach mit. Er ist so betrunken, daß er davon gar nichts merken wird. Er kann im Palast seinen Rausch ausschlafen, und dann haben wir ihn gleich zur Hand.«
Einer der Helfershelfer grinste.
»Es ist auch bequemer«, meinte er. »Wenn er lügen sollte, so haben wir gleich die Folterkammer bei uns.«
Der Sayd nickte wohlwollend.
Sechzehn Fäuste packten den schlafenden Ugawambi, zerrten ihn hoch. Vier Mann an jeder Seite, so trugen sie ihn weg. Sie waren jedoch klug genug, die Gasse, in der der Schwarze wohnte, zu meiden, schlugen einen Bogenund gingen eine Gasse entlang, die ein ganzes Stück weiter unten begann.
»Was nun?« fragte Ojo.
»Wir müssen ihnen folgen, um zu sehen, wo sie ihn hinbringen.«
»Ist es nicht unglaublich, was sich diese Burschen da leisten?« fragte Ojo. »Trotz seiner Trunkenheit dürfen sie nicht so mit ihm verfahren.«
Michel ballte die Fäuste. In ihm kochte es. Er hatte eine unbeschreibliche Wut. Hätte er seine Muskete bei sich gehabt, so hätte er ohne Zögern mitten in die frechen Burschen hineingeschossen. Es war der Höhepunkt der Anmaßung und Unverschämtheit, am hellichten Tage einfach einen Menschen zu entführen, weil man etwas von ihm wissen wollte.
»Verlaß dich drauf, Diaz, das werden wir den Herrschaften heimzahlen.«
Dann machten sie sich auf, um den Menschenräubern zu folgen.
17
Ugawambi erwachte mit schwerem Kopf. Die Schläfen pochten wie Hämmer. Mühsam öffnete er die Augen. Um ihn war Finsternis.
Wo war er? Eine solche Dunkelheit herrschte doch in seiner Hütte sonst nie. Er richtete sich halb auf.
»He, Weib«, rief er, »wo bist du? Wie komme ich in deinen unsauberen Stall? Wie kannst du dich unterstehen, mich von der schönen grünen Wiese hierher zu bringen?«
Er sank wieder zurück. Niemand antwortete ihm. Dann stöhnte er.
»Sie sind nie da, die Weiber, wenn man sie braucht«, murmelte er.
Er griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Daß er solche Schmerzen hatte, kam nur daher, daß man ihn seinen Rausch nicht in der freien Natur hatte ausschlafen lassen. In seiner Hütte stank es ewig. Die dumpfe Luft darin brachte im Schlaf keine Erfrischung.
Als sich nichts rührte, blieb er noch eine Zeitlang still liegen. Endlich wurde sein Blick klarer.
Doch die Dunkelheit wich nicht.
»Schon wieder Nacht«, murmelte er.
Schwerfällig erhob er sich und tastete sich an der Wand entlang. Plötzlich stutzte er. Das war doch gar nicht die Hütte?
Seine Bewegungen wurden hastiger. Zum Teufel, wo befand er sich? Steinmauern, nichts als Steinmauern waren um ihn. Das einzige Möbel in diesem Raum schien das Lager zu sein, von dem er sich soeben erhoben hatte.
Seine Hände fuhren unruhig an der Mauer entlang. Da — hier war ein Riß. Seine Finger tasteten behutsam darüber. An der Regelmäßigkeit spürte er, daß es eine Türritze sein mußte. Die Hände glitten weiter. Ja, hier war eine Tür. Er fühlte das Holz.
Weit enfernt davon, eine Falle zu wittern, schüttelte er den Kopf und kehrte zu seinem Lager zurück.
Was mochte geschehen sein? War er mit der Flasche vielleicht gar nicht auf die Wiese hinausgegangen? Hatte er vielleicht gar Madagaskartown verlassen und war ins Europäerviertel gelangt, wo ihn die portugiesischen Polizisten dann gefunden hatten?Er starrte in die Dunkelheit.
Es mußte doch jemand kommen, der ihn befreite! Irgend jemand muß sich doch um ihn kümmern! Hatten sie ihn vergessen?
Instinktiv fühlte er Angst in sich aufsteigen. Dann schnellte er plötzlich hoch. Mit einem Satz stand er an der Tür und hämmerte mit den Fäusten dagegen.
Er brauchte nicht lange zu warten; denn kurz darauf hörte er, wie von draußen ein Schlüssel ins Loch gesteckt wurde.
Die Tür sprang auf.
»Bist du wieder bei dir?« fragte eine Stimme auf arabisch.
»Wie komme ich hierher?«
»Unsere Männer haben dich gebracht.«
»Wer ist das? Unsere Männer?«
»Die Palastwache Imi Bejs.«
Ugawambi glaubte, nicht recht gehört zu haben. Ein eisiger Schreck durchzuckte ihn. Wollte man sich an ihm rächen? Aber woher sollten die Männer der Leibwache wissen, was aus Imi Bej geworden war!
»Imi Be-Be-Be-Bej?« stotterte er.
»Da bist du wohl sehr überrascht?«
»Was wollt ihr von mir?« Ugawambi hatte sich wieder gefaßt.
»Das wirst du bald hören. Ich schließe dich jetzt wieder ein, um dem Gesandten des Imam zu melden, daß du nüchtern bist.«
Die Tür knallte ins Schloß. Dunkelheit und beängstigende Stille waren wieder um Ugawambi.
Читать дальше