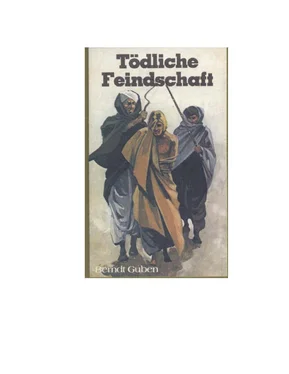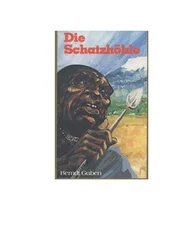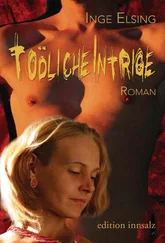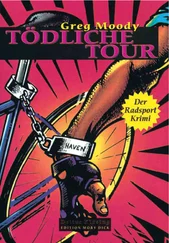»Können wir gehen, Señor Doktor? Ich bin müde wie ein Hund.«
»Ist das Duell beendet?« wandte sich Michel an den Major.
»Ja. — Natürlich, wenn ihr meint — — ?«
»Bueno, wir meinen.«
Ojo wandte sich noch einmal zu den wartenden Offizieren um, hob die Hand und rief: »Adiós, Señores!«
Noch am Vormittag wußte bereits das gesamte Hotel über den Ausgang des Duells Bescheid.
Weder der General noch seine Damen ließen sich irgendwo blicken. Und am Abend kam Tscham, der in der Stadt einige Besorgungen erledigt hatte, in das Zimmer gestürzt und rief aufgeregt:
»Denkt euch, was mir der Empfangschef erzählt hat, der General hat sein Abschiedsgesuch eingereicht. Er will den Dienst bei der Armee quittieren. Die Leute behaupten, er werde diese Schande nie mehr abwaschen können.«
»So eine Dummheit«, brummte Ojo. »Nun ist nicht der Empfangschef, sondern der General seinen Posten los. Was wird er nun machen? Um noch etwas Vernünftiges zu lernen, ist er sicher schon viel zu alt.«
Michel lachte.
»Ich wußte gar nicht, Diaz, daß du dich so um andere sorgen kannst.«
Ojo machte sich an seinem Gepäck zu schaffen. Endlich hatte er den kleineren Sack mit den Edelsteinen herausgefischt. Er öffnete ihn, griff hinein und holte eine Handvoll Diamanten heraus.
»So werde ich dem alten General ein paar Steine geben. Ihr meint doch nicht, daß er davon unglücklich wird?«
Noch bevor Michel etwas erwidern konnte, war Ojo zur Tür hinaus.
Der General starrte ihn an wie ein Gespenst, als Ojo das Appartement betrat.
»Ich habe gehört, Señor, daß Ihr Euern Dienst quittieren wollt?«
Don Hernán antwortete mit zitternder Stimme :
»Seid Ihr gekommen, um Euch an meinem Unglück zu weiden?«
»Ich bin doch kein Schuft«, erwiderte Ojo empört. »Ich wollte Euch nur eine kleine Entschädigung bringen. Da —, nehmt.«
»Wa — wa — wa —, was ist das?«
»Es sind wunderbare, herrliche, nie gesehene Diamanten«, sagte Ojo. »Ich habe genug davon.
Wenn Ihr nach Portugal kommt, könnt Ihr sie verkaufen. Ihr werdet soviel Geld dafür bekommen, daß Ihr bis an Euer Lebensende sorgenfrei leben könnt.«
In der Annahme, daß der General etwa zu stolz sein könnte, das Geschenk anzunehmen, drehte sich Ojo um und verließ eilig das Zimmer.
Don Hernán starrte wie versteinert auf den Reichtum, der in einem kleinen Haufen auf dem Tisch lag. Er kämpfte einen bitteren, harten Kampf mit sich. In seiner Seele bekriegten sich der General und der Mensch, der nun sein Leben, wenn auch nicht gerade in bitterer Not, so doch auch nicht in den bisherigen Formen zu Endeführen sollte. Schließlich gewann der Mensch die Oberhand. Don Hernán dachte an Frau und Tochter und daran, daß er für diese keinen Mann gefunden hatte. Mit den Werten aber, die da vor ihm auf dem Tisch lagen, konnten er und seine Familie weiterhin ein sorgenfreies, standesgemäßes Leben führen.
Außerdem war er so klug, daß er sich vornahm, niemandem gegenüber etwas über das unerwartete Geschenk verlauten zu lassen.
Als er die Steine verstaut hatte, setzte er sich in einen Sessel und grübelte über seinen Gegner nach. Was war das für ein Mensch? Zweifelsohne mußte er verrückt sein. Weshalb kümmerte er sich noch um das Wohl und Wehe des Besiegten, dem er doch vorher bereits das Leben geschenkt hatte?
Don Hernán dachte noch jahrelang in jeder Mußestunde über dieses Phänomen nach. Auf das einfachste, nämlich, daß ein Mensch gut, rauh, tapfer und kindlich zugleich sein konnte, daß es Ojo einfach ein Bedürfnis gewesen war, einem alten, geschlagenen Mann eine Freude zu bereiten, darauf kam er nie.
16
Michel und Ojo verbrachten die nächsten Tage damit, am Hafen Ausschau nach einem Schiff zu halten, dessen Bestimmungsort — wenn schon nicht Hamburg — so doch wenigstens ein Hafen an der französischen Nordküste war. Es gab mehrere Frachtschiffe, die Passagiere beförderten.
Aber erstens hatten die meisten von ihnen kein sehr vertrauenerweckendes Aussehen, und zweitens fand sich nicht eines, dessen Route weiter nördlich als Bordeaux endete.
Michel aber hatte nicht die Absicht, mit Postkutschen oder sonstigem unsicherem Gefährt quer durch Frankreich zu reisen. Außerdem wollte er unbedingt nach Hamburg, um auf der Bank, die ihm Kapitän Weber empfohlen hatte, die Diamanten zu deponieren. Wenn er, wie er vorhatte, tatsächlich nach Kassel gehen würde, dann war ihm ein Sack voll solcher Kostbarkeiten nur hinderliches Gepäck.
Tscham hütete, während sie die Stadt durchstreiften, auf Michels Geheiß das Bett. Der tapfere junge Radscha hatte viel nachzuholen. Die Expedition zum Kilimandscharo hatte ihm mehr zugesetzt, als er wahrhaben wollte. Wenn auch das Fieber nicht mehr wiederkam, hatte es doch erheblich an seinen Kräften gezehrt.
So mußte er denn im Bett bleiben und sich pflegen lassen.
Essen und Schlafen hatte ihm Michel verordnet.
Am Morgen des fünften Tages nach ihrer Ankunft in Sansibar sagte Ojo mißmutig:
»Wenn wir aus diesem verdammten Backofen schon nicht fortkönnen, so sollten wir wenigstens versuchen, ob wir nicht doch noch die Diebe fassen können, die uns auf Imi Bejs Geheiß hin bestohlen haben.«
»Hm«, meinte Michel, »der Gedanke ist nicht schlecht. Nur zweifle ich daran, daß wir dadurch die Steine wiederbekommen.«
»Wir können doch des Nachts ganz einfach einen kleinen Spaziergang durch Imi Bejs Palast machen.«
»Dort werden wir sie mit Sicherheit nicht mehr finden.«»Und weshalb nicht?«
»Ich glaube, daß der Bej den größten Teil seiner Beute dem Imam von Maskat ausgeliefert hat.
Ich habe ihn ja belauscht, als er zu seinem Vertrauten darüber sprach, daß er einst Gouverneur von Sansibar werden wollte. Hier unten ist es im allgemeinen üblich, daß man sich eine solche Würde erkauft.«
Ojo zuckte die Schultern.
»Das ist Pech. Da kann man nichts machen.«
»Zur Zerstreuung unserer Langeweile weiß ich etwas anderes«, sagte Michel.
»Ja?«
»Laß uns heute Ugawambi aufsuchen. Wollen sehen, was der Bursche macht. Ich habe dem König der Wadschagga ohnehin versprochen, mich um ihn zu kümmern, damit er nicht wieder Dummheiten begeht.«
»Gute Idee«, freute sich Ojo. Er war für jeden Vorschlag dankbar, der Abwechslung in die Eintönigkeit des Daseins brachte.
So gingen sie denn, nachdem sie Tscham das Frühstück aufs Zimmer hatten schicken lassen, hinüber nach Madagaskartown. Sie hatten, obwohl sie sich längst wieder anständige Kleidung besorgt hatten, zu diesem Zweck ihre alten Lumpen angezogen. So stachen sie von dem Gewimmel der Neger, der schmutzigen Araber und der vielen weißen Tagediebe nicht besonders ab.
Als sie in die Gasse einbogen, in der Ugawambi wohnte, kamen sie gerade zurecht, um zu sehen, wie ein für diese Gegend ungewöhnlich gut gekleideter Araber die Hütte Ugawambis verließ.
»Nanu?« sagte Ojo. »Der Gute hat aber vornehmen Besuch.«
»Es sieht fast so aus, als knüpfte unser Freund schon wieder Verbindungen an.«
»Verbindungen? Ihr meint, daß es schon wieder Sklavenjäger gäbe, die Appetit auf eine Reise ins Dschaggaland hätten?«
»Ich will es nicht hoffen. Aber man kann nie wissen. Nun, wir werden ja sehen.«
Sie gingen langsam weiter.
Da bemerkte Michel, wie der Araber die Hand hob. Das tat er mehrere Male hintereinander, ohne den Schritt zu verlangsamen.
»Was macht der da?« fragte Ojo.
»Wir müssen abwarten.«
In der Gasse waren nicht viele Menschen. Um so mehr mußte es auffallen, als sich auf das Zeichen des Arabers plötzlich sechs, sieben, acht Gestalten einfanden, die, unauffällig zwar, aber doch unverkennbar die gleiche Richtung wie der Araber einschlugen.
Читать дальше