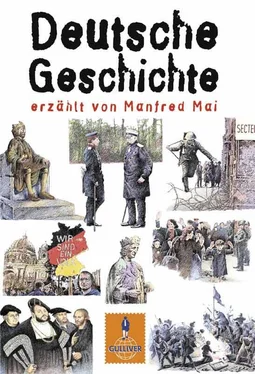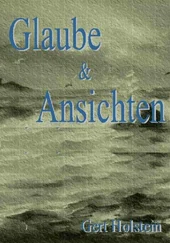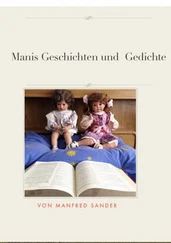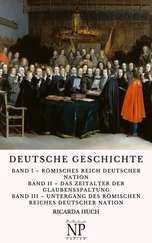Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Besonders verworren und angespannt war die Lage in Böhmen. Dort wurde im Jahr 1617 der katholische Habsburger Ferdinand II. König. Er verlangte von den Protestanten, den katholischen Glauben anzunehmen, ließ ihre Kirchen schließen und sogar niederreißen. Und er wollte die politischen Mitbestimmungsrechte der böhmischen Landstände (die Vertretung von Adel, Kirchen und Bürgertum) aufheben. Da versammelten sich am 23. Mai 1618 böhmische Adlige und Bürger vor der Prager Burg, drangen schließlich in die Burg ein und warfen drei Vertreter des Königs aus dem Fenster. Dieser »Prager Fenstersturz« war der Auftakt zu einem entsetzlichen Krieg, der 30 Jahre dauern sollte. Kein Krieg hatte je so viel Leid und Elend über die Menschen gebracht wie dieser »Dreißigjährige Krieg«. In vielen Schriften überboten sich später die Chronisten bei den Schilderungen der Grausamkeiten, die von Soldaten begangen wurden. Was aber waren die Hintergründe dieses Krieges?
Der Dreißigjährige Krieg wurde und wird allgemein als Glaubenskrieg bezeichnet. Für die erste Phase traf das auch noch zu. Da wollten die Katholiken unter Führung der Habsburger und Wittelsbacher das Reich wieder katholisch machen. Gleichzeitig aber ging es um die Aufteilung der Macht zwischen der kaiserlichen Zentralgewalt und den Landesfürsten. Das zeigte sich deutlich, als die kaiserlichen Truppen unter Wallenstein ganz Norddeutschland erobert hatten. Im Hochgefühl des Sieges erließ Kaiser Ferdinand ein Gesetz, nach dem alle protestantisch gewordenen Kirchengüter dem Reich zufallen sollten. Diese Maßnahme scheiterte am geschlossenen Widerstand der katholischen Kurfürsten. Denn die großen Gebiete hätten die Besitzverhältnisse und damit die Macht zu Gunsten des Kaiserhauses verschoben. Das zu verhindern war den katholischen Kurfürsten viel wichtiger als die Glaubensfrage.
Auch als die Nachbarländer in den Krieg eingriffen, ging es mehr um Machtfragen als um den rechten Glauben. So förderte das katholische Frankreich aus dem Hintergrund den Widerstand der katholischen deutschen Fürsten gegen den katholischen Kaiser, nur um die Habsburger zu schwächen und selbst die Vormacht in Europa zu gewinnen. Aus diesem Grund unterstützte Frankreich auch den Vorstoß des protestantischen Schwedenkönigs Gustav Adolf im Sommer 1630. Der Schwede wurde von den Protestanten als »Befreier von der Habsburger Tyrannenherrschaft« gefeiert, und er wollte seinen Glaubensbrüdern durchaus helfen. Aber vor allem hoffte er auf Landgewinne in Norddeutschland, um die schwedische Herrschaft an der Ostsee dauerhaft zu sichern.
Katholisch hin, protestantisch her, den Mächtigen ging es also, wie so oft in der Geschichte, nur um mehr Macht. Und wie so oft mussten die kleinen Leute darunter leiden. Wie viele Menschen ihr Leben in diesem Krieg verloren haben, lässt sich nicht genau sagen. Die Schätzungen schwanken zwischen 7 und 8 Millionen. Zu Beginn des Krieges hatte Deutschland etwa 17 Millionen Bewohner, am Ende waren es noch ungefähr 10 Millionen. Und viele der Überlebenden beneideten die Toten.
Wie der Krieg, so zogen sich auch die Friedensverhandlungen beinahe endlos hin. Am 24. Oktober 1648 wurde der »Westfälische Friede« verkündet. Dabei wurde der Augsburger Religionsfriede von 1555 erneut bekräftigt und ergänzt. Ein Religionswechsel der Obrigkeit musste nun von den Untertanen nicht mehr nachvollzogen werden. Das war ein wichtiger Schritt hin zur Glaubensfreiheit, auch wenn sie noch nicht gesichert war.
Die deutschen Fürsten gingen gestärkt aus dem Krieg hervor. Kaiser Ferdinand III. akzeptierte ihre weitgehende Selbstständigkeit mit eigener Gesetzgebung, Rechtsprechung und Steuerhoheit. Sie erhielten sogar das Recht, Bündnisse untereinander und mit fremden Staaten zu schließen, solange diese nicht gegen Kaiser und Reich gerichtet waren. Der Kaiser selbst war bei seinen Entscheidungen an die Zustimmung des Reichstages gebunden.
Auch nach außen wurde das Reich als Ganzes durch den Friedensvertrag geschwächt. Es musste Gebiete an Frankreich und Schweden abtreten; die Niederlande und die Schweiz schieden aus dem Reich aus. Die neue europäische Ordnung entsprach in erster Linie französischen Interessen. Und weil Deutschland Jahrzehnte brauchte, um sich von den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu erholen, löste Frankreich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation für die nächsten zweihundert Jahre als Führungsmacht in Europa ab.
Der Staat bin ich
Wer die Entwicklung im Deutschen Reich nach dem Westfälischen Frieden verstehen will, muss einen Blick nach Frankreich werfen. Dort übernahm der 23-jährige Ludwig XIV. im Jahr 1661 die Regierungsgeschäfte. Als Erstes holte er Männer in seine Regierung, die ihm bedingungslos gehorchten. Die hohen Adligen, die zuvor oft ihre eigene Politik betrieben hatten, verloren ihre Ämter. Auch draußen im Land überließ er die Macht nicht mehr den Adligen. Er setzte für jeden Amtsbezirk einen obersten Beamten, den Intendanten, ein. Der musste mit Hilfe von Amtsdienern und Polizisten für den Einzug der Steuern und für Ordnung sorgen. Der König konnte ihn jederzeit entlassen, wenn er seine Pflichten nicht erfüllte. So wurde der ganze Staat einheitlich regiert und verwaltet. Alle Steuereinnahmen kamen in die Staatskasse, und der König bestimmte, wofür das Geld ausgegeben wurde. Auch neue Gesetze erließ der König und selbst über Krieg und Frieden entschied er allein. Er besaß also die ganze, die absolute Macht im Staat. Er regierte »absolutistisch«. Ludwig XIV, der »Sonnenkönig«, soll sogar gesagt haben: »Der Staat bin ich.«
Außenpolitisch verfolgte er das Ziel, Frankreichs führende Stellung in Europa zu festigen und auszubauen. Dafür wurde das Heer stark vergrößert und besser ausgebildet. Das kostete natürlich viel Geld, ebenso wie der Bau des riesigen Schlosses von Versailles und das prunkvolle, ja verschwenderische Leben am Hof. Das notwendige Geld zu beschaffen war Aufgabe des Ministers Colbert. Er entwarf eine Wirtschaftspolitik nach folgenden Grundgedanken: Frankreich muss mehr Waren herstellen, als die eigene Bevölkerung braucht. Es müssen möglichst viele Waren aus- und möglichst wenig Waren eingeführt werden, damit der Überschuss möglichst groß ist.
Zu diesem Zweck förderte Colbert den Bau großer Betriebe, in denen hochwertige Güter wie Kutschen, Möbel, Teppiche, Kleidung und anderes mehr in großer Zahl hergestellt werden konnten. Und zwar durch hunderte von Fach- und Hilfsarbeitern. Um die Güter aus solchen »Manufakturen« schnell verkaufen zu können, wurden Straßen, Kanäle und Häfen gebaut.
Ausländische Waren wurden mit hohen Zöllen belegt und waren deshalb für die Franzosen sehr oft zu teuer.
Diese Wirtschaftspolitik, »Merkantilismus« genannt, nahm wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse des Volkes. Ihr oberstes Ziel war, Geld in die Staatskasse zu bringen.
Überall in Europa ahmten die Fürsten den Regierungsstil und die Politik des französischen Königs nach. Auch die vielen deutschen Fürsten wollten zumindest kleine Sonnenkönige sein. Sie ließen prächtige Residenzen bauen, hielten darin Hof und regierten absolutistisch wie ihr Vorbild. Wie in Frankreich kostete das sehr viel Geld, und manche Fürsten stürzten ihre Länder in große Finanznot. Darunter hatte in erster Linie das Volk zu leiden, weil immer mehr Steuern und Abgaben von ihm verlangt wurden. Vor allem die Bauern wurden bis zum Letzten ausgepresst. Neben den vielen Abgaben mussten sie beim Bau der oft riesigen Residenzen und Abteien immer wieder Frondienste leisten, ebenso wenn Rathäuser, Kirchen, Pfarrhäuser und Kasernen gebaut, Wege und Straßen angelegt wurden. Das sollte nicht vergessen, wer heute die prächtigen Bauwerke aus jener Zeit bewundert.
Die Preußen kommen
Im 17. Jahrhundert gewann in Deutschland ein altes Fürstengeschlecht an Bedeutung: die Hohenzollern. Seit dem 11. Jahrhundert hatten sie ihren Besitz zuerst zwischen Donau und Neckar, dann bis ins Fränkische stetig vergrößert. Für treue Dienste hatte König Sigismund dem hohenzollerischen Grafen Friedrich VI. im Jahr 1415 die Markgrafschaft Brandenburg übertragen und ihn zum Kurfürsten gemacht. Später erhielten die Hohenzollern noch andere Grafschaften und zuletzt 1618 das Herzogtum Preußen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.