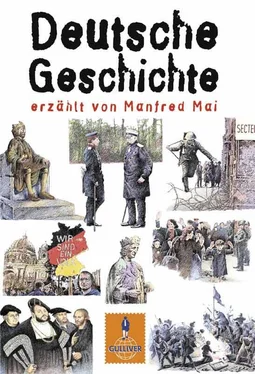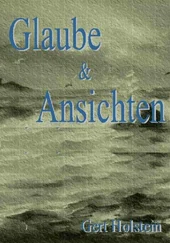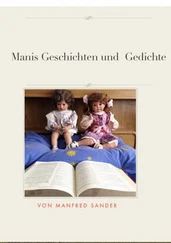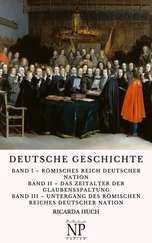Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Am 1. Januar 1995 traten mit Finnland, Österreich und Schweden drei weitere Staaten der EU bei. Von den nunmehr 15 EU-Staaten führten elf am 1. Januar 1999 die neue Währung, den Euro, ein – zunächst allerdings nur als Rechnungseinheit; in den Händen halten konnte man das neue Geld erst drei Jahre später.
Obwohl die Umstellung am 1. Januar 2002 problemlos klappte, trauerten viele Menschen in Europa ihren bisherigen Münzen und Scheinen nach. Besonders verständlich ist das bei den Ostdeutschen, mussten sie sich doch zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Jahren umstellen und an neues Geld gewöhnen; die Westdeutschen vermissten ihre stabile D-Mark und klagten bald lautstark über den »Teuro«.
Am 1. Mai 2004 nahm die EU mit Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Malta und dem griechischen Teil Zyperns zehn neue Mitglieder auf. Fünfzehn Jahre nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs beendete diese so genannte »Osterweiterung« die Spaltung Europas endgültig, die 1945 von den Alliierten beschlossen worden war.
Damit umfasst die Europäische Union einen Wirtschaftsraum mit 450 Millionen Menschen und verfügt über eine weit größere Bevölkerung als die USA mit 280 Millionen. Und schon stehen mit Rumänien, Bulgarien und der Türkei weitere Beitrittskandidaten bereit. Welche Länder wann aufgenommen werden, hängt von den jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Zuständen ab. Ziel der EU ist es, Demokratie und Marktwirtschaft nach Osten und Südosten auszudehnen, nicht zuletzt, um die politische Stabilität in diesen Regionen zu fördern.
Ob sich die EU mit der Aufnahme von immer mehr Staa ten übernimmt, wie die Kritiker meinen, oder ob sie »eine Weltmacht im Werden« ist, wie es der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer voraussagt, wird die Zukunft zeigen.
Nie wieder Krieg?
Nachdem die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs alle Rechte und Vorbehalte aufgegeben hatten, war das wiedervereinigte Deutschland nun ein souveräner Staat – mit weitreichenden Konsequenzen. Während des »Kalten Krieges« hatten sich beide Deutschland aus internationalen Konflikten weitgehend heraushalten und sich hinter ihrer jeweiligen Supermacht »verstecken« können. Nun wuchs dem größten Land im Zentrum Europas mehr Verantwortung zu. Die wurde in Anbetracht der deutschen Geschichte, aber auch aus Unsicherheit und aus Rücksicht auf die europäischen Partner zunächst sehr zurückhaltend wahrgenommen. Diese Zurückhaltung gefiel manchen Bündnispartnern allerdings nicht; vor allem die USA forderten eine aktivere Unterstützung der westlichen Positionen.
Zur ersten Nagelprobe kam es im Golfkrieg 1991. Die USA verlangten neben materieller Unterstützung auch den Einsatz deutscher Truppen am Golf. Mit Hinweis auf das Grundgesetz lehnte der Bundestag die Entsendung deutscher Soldaten ab, übernahm dafür später mit 9 Milliarden Euro einen großen Teil der Kosten – was Deutschland den Vorwurf der »Scheckbuch-Diplomatie« einbrachte.
Auf Dauer konnte das nicht der außen- und sicherheitspolitische Kurs der Bundesrepublik sein, das war den meisten deutschen Politikern klar. Aber wie sollte der neue Kurs aussehen?
Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien verlangte eine erste Antwort. Die Bundesregierung gab sie im Februar 1993, indem sie beschloss, dass sich deutsche Soldaten an der Überwachung des UN-Flugverbots über Bosnien-Herzegowina beteiligen sollten. SPD und FDP wollten den Einsatz durch das Bundesverfassungsgericht verbieten lassen. Doch das höchste deutsche Gericht lehnte deren Anträge ab, weil sonst ein »Vertrauensverlust bei den Bündnispartnern und allen europäischen Nachbarn unvermeidlich wäre«.
Damit kamen zum ersten Mal seit 1945 wieder deutsche Soldaten in einem Krieg zum Einsatz, wenn auch nur zur Überwachung eines Flugverbots.
Am 12. Juli 1994 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass humanitäre und militärische Einsätze der Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebietes mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Nun konnten die Politiker also nicht mehr verfassungsrechtlich argumentieren, nun mussten sie politisch entscheiden, unter welchen Bedingungen sie bereit waren, deutsche Soldaten in Krisen- und Kriegsgebiete zu schicken.
Es kam zu Einsätzen bei der UN-Blauhelmtruppe, die in Krisengebieten mithelfen soll, den Frieden zu sichern. Zwischen 1995 und 1998 beschloss der Bundestag mehrfach und mit immer größeren Mehrheiten, der internationalen Friedenstruppe in Bosnien-Herzegowina bis zu 4 000 deutsche Soldaten zur Verfügung zu stellen.
Am 27. September 1998 wurde die christlich-liberale Regierung unter Helmut Kohl nach 16 Jahren abgewählt. Die neue rot-grüne Regierung mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Außenminister Joschka Fischer an der Spitze stand sofort vor der schwierigen Aufgabe, über den ersten Kampfeinsatz deutscher Soldaten seit 1945 entscheiden zu müssen.
Nachdem das ehemalige Jugoslawien auseinander gefallen war, kam die Region nicht zur Ruhe. Besonders kritisch war die Lage im Kosovo. Dort herrschten seit langem 200 000 Serben über zwei Millionen Albaner. Die wollten das nicht länger dulden und verlangten größere Autonomie von der serbischen Zentralregierung unter Ministerpräsident Milosevic. Dessen Politik hatte zum Ziel, den Kosovo »albanerfrei« zu machen. Bis 1998 flohen hunderttausende Albaner vor den Gewalttaten serbischer Militäreinheiten aus ihrer Heimat. Doch damit war Milosevic noch nicht zufrieden; er schickte Erschießungskommandos durch den Kosovo, die schreckliche Massaker verübten. Um den drohenden Völkermord zu verhindern, forderte der UN-Sicherheitsrat Milosevic mehrfach auf, das Blutvergießen zu beenden. Als sämtliche diplomatischen Versuche ohne Erfolg blieben, drohte die NATO mit Luftangriffen.
Es ist eine besondere Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die rot-grüne Koalition über einen von Deutschland mit zu führenden Krieg entscheiden musste. Denn viele ihrer Mitglieder, vor allem der Grünen, stammten aus der Friedensbewegung oder standen der Friedensbewegung nahe. Wer etwa dem 68er und Mitbegründer der Grünen Joschka Fischer in seinen wilden Jahren prophezeit hätte, er würde einmal mit Engelszungen von der Notwendigkeit eines Militäreinsatzes reden, wäre wohl für verrückt erklärt worden. Nicht selten war in den Zeiten der Kosovo-Entscheidung zu hören, nun seien auch die Grünen endgültig in der politisch-parlamentarischen Wirklichkeit angekommen. Innerhalb der Grünen ist die Frage der richtigen Friedenspolitik bis heute umstritten.
Von März bis Juni 1999 bombardierten NATO-Flugzeuge, darunter deutsche Tornados, serbische Einrichtungen im Kosovo. Anschließend überwachte eine internationale Truppe, die Kosovo Force (KFOR), die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen. Mit dabei waren bis zu 8 500 Bundeswehrsoldaten.
Innerhalb von zehn Jahren war die Bundesrepublik Deutschland von einem »Sonderfall« zu einem Partner unter Partnern geworden und damit endgültig ein »normaler« Staat.
Schon zwei Jahre später begann der nächste Ernstfall, als arabische Selbstmordattentäter mit entführten Flugzeugen ins New Yorker World Trade Center flogen und dabei über 3 000 Menschen in den Tod rissen. Der amerikanische Präsident George W. Bush betrachtete das als Kriegserklärung und kündigte einen »Feldzug gegen den internationalen Terrorismus« an. Ohne zu zögern, sicherte Bundeskanzler Schröder den USA »uneingeschränkte Solidarität« zu. Erstes Ziel dieses »Feldzuges« gegen den Terrorismus war das Taliban-Regime in Afghanistan, das Terroristen Unterschlupf und Hilfe gewährte. Beim Krieg gegen die Taliban wurden die USA von vielen Ländern unterstützt. Doch als Präsident Bush den irakischen Diktator Saddam Hussein und sein Regime als nächstes Kriegsziel nannte, bröckelte die gemeinsame Front. Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer stellten sich zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac an die Spitze derer, die den Irak mit friedlichen Mitteln entwaffnen und einen Krieg verhindern wollten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.