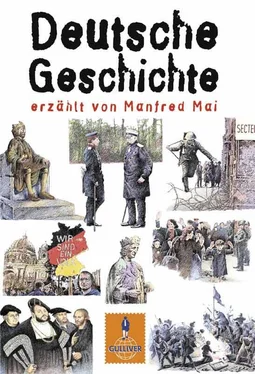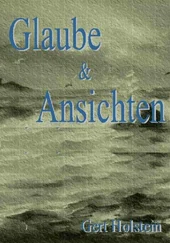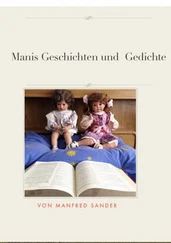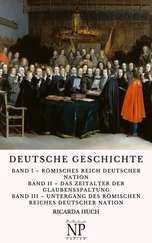Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Demonstranten in der DDR wurden zunächst noch niedergeknüppelt und verhaftet. Doch mit ihrer starren Haltung förderte die Staats- und Parteiführung nur das Anwachsen der Protestbewegung. Selbst Gorbatschows mahnende Worte »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« stießen bei Honecker auf taube Ohren. Als dann im Herbst 1989 mächtige Demonstrationszüge durch Leipzig, Dresden, Ostberlin und andere Städte zogen, wurde im SED-Politbüro ernsthaft darüber diskutiert, ob man wie 1953 Panzer gegen das eigene Volk rollen lassen sollte. Warum das letztlich nicht geschah, ist bis heute noch ungeklärt. Ein wichtiger Grund dürfte gewesen sein, dass der sowjetische Botschafter in der DDR keinerlei Rückendeckung oder gar Unterstützung des »Großen Bruders« zusagte. Damit war das SED-Regime praktisch am Ende.
Aber Honecker lehnte alle Reformvorschläge weiterhin kategorisch ab. Da wurde im Politbüro zum ersten Mal Kritik an seinem Führungsstil laut. Um an der Macht zu bleiben, setzten die führenden Genossen ihren Generalsekretär am 18. Oktober ab und wählten Egon Krenz zu seinem Nachfolger. Der kündigte Reformen an, versprach Reiseerleichterungen und forderte die Bürgerinnen und Bürger zur »Ausgestaltung der sozialistischen Gesellschaft« auf. Doch die Bürgerinnen und Bürger trauten den SED-Funktionären nicht. Sie demonstrierten weiter und in immer größerer Zahl für Freiheit und Demokratie. In einer Mischung aus Zorn und wachsendem Selbstbewusstsein erschallte der Ruf »Wir sind das Volk!« immer lauter. Und die neue DDR-Führung gab dem Volkswillen erstmals nach. Am Abend des 9. November 1989 öffnete sie die Grenzübergänge und noch in der Nacht besuchten zehntausende DDR-Bürger West-Berlin. Deutsche aus Ost und West feierten ein Fest, wie in Deutschland noch keines gefeiert worden war.
Wir sind ein Volk!
Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte war eine Revolution erfolgreich – und das auch noch ohne Gewalt! Dass es den Menschen im Osten Deutschlands gelang, das SED-Regime mit friedlichen Mitteln in die Knie zu zwingen, ist eine große historische Leistung. Die Frage war nun, was aus der DDR werden sollte. Darüber verhandelten Vertreter der Oppositionsgruppen, der Volkskammerparteien und der Regierung am so genannten »runden Tisch«. Drei Konzepte standen zur Wahl:
Eine eigenständige DDR nach dem Muster eines »dritten Weges« zwischen Kapitalismus und Staatssozialismus.
Eine Konföderation der beiden deutschen Staaten.
Ein rascher Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland.
Während am »runden Tisch« noch diskutiert wurde, machten die weiterhin stattfindenden Demonstrationen deutlich, wohin der Weg gehen sollte. Aus der Parole »Wir sind das Volk!« wurde »Wir sind ein Volk!«. Die Mehrheit der DDR-Bürger wollte keine wie auch immer reformierte DDR, sondern die Vereinigung mit der Bundesrepublik.
Die ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR am 18. März 1990 bestätigten diesen Wunsch. Und nach vielen Verhandlungen – auch mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs – trat die DDR am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik bei. An diesem Tag endete die Teilung Deutschlands und ein neues Kapitel der deutschen Geschichte begann.
»Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört«, hatte Willy Brandt nach dem Fall der Mauer gesagt und damit vielen Menschen »hüben und drüben« aus dem Herzen gesprochen.
Die Deutschen in Ost und West hatten die Wiedervereinigung wie im Rausch erlebt. Diesem Rausch folgte ein gewaltiger Kater. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte den Eindruck vermittelt, der Einigungsprozess werde keine besonderen Kosten verursachen, im Gegenteil, die deutsche Wirtschaft werde schon bald einen kräftigen Aufschwung erleben, von dem West und Ost gleichermaßen profitieren würden. Im Bundestagswahlkampf 1990 versprach er »blühende Landschaften« und weckte damit große Erwartungen bei den »Brüdern und Schwestern im Osten«. Die erfüllten sich nicht oder nur teilweise und in jedem Fall viel langsamer als gedacht; vor allem aber mussten sie teuer bezahlt werden.
Die Umgestaltung der zentral gelenkten Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft verlief nicht so reibungslos wie erhofft. Bis April 1991 fiel die ostdeutsche Industrieproduktion auf 30% des Niveaus von 1989 zurück, weil die veralteten Fabriken nicht konkurrenzfähig waren und der ehemalige Ostblock als Abnehmer ausgefallen war. Die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch – sie ist bis heute prozentual mehr als doppelt so hoch wie in den alten Bundesländern.
Gemildert wurden die dadurch entstandenen Probleme und Härten mit finanziellen Hilfen aus dem Westen. Über eine Billion Euro flossen für den »Aufbau Ost« bisher in die neuen Bundesländer, eine ungeheuer große Summe. Sie verbesserte das Leben der Menschen spürbar, reichte jedoch längst nicht aus, um Ostdeutschland in eine »blühende Landschaft« zu verwandeln.
Problematisch war und ist, dass sich der Staat immer höher verschulden musste und immer noch muss, um den »Aufbau Ost« zu finanzieren.
Weil Mitte der 90er Jahre außerdem die Weltwirtschaft ins Stocken geriet, stieg die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf über vier Millionen und die Steuereinnahmen des Staates sanken; noch mehr Schulden waren die Folge. Im Jahre 2003 beträgt der Schuldenstand von Bund, Ländern und Gemeinden rund 1,5 Billionen Euro, was eine enorme Belastung für die kommenden Generationen bedeutet.
Waren die Westdeutschen anfangs bereit, für den »Aufbau Ost« zu bezahlen, so murrten sie bald über den seit 1991 zu entrichtenden »Solidaritätszuschlag« und höhere Steuern. Die neuen Bundesländer erschienen vielen wie ein Fass ohne Boden. In Ostdeutschland wiederum litten die Menschen darunter, »am Tropf der Wessis« zu hängen. Die finanzielle Unterstützung konnte auch nicht verhindern, dass viele »Ossis« mit der früher unbekannten Arbeitslosigkeit, mit dem Verlust der sozialen Sicherheit und mit den neuen Freiheiten nicht zurechtkamen.
Wie oft in solchen Situationen machten sich nun Unzufriedene – unbelehrt von der deutschen Geschichte – auf die Suche nach Sündenböcken. Man fand sie vor allem in ausländischen Arbeitnehmern. Im Herbst 1991 häuften sich in Deutschland Gewalttaten gegen Ausländer und Asylbewerber. Im sächsischen Hoyerswerda und in Rostock versuchten rechtsradikale Jugendliche, ein Asylantenwohnheim in Brand zu stecken. Besonders schändlich war, dass die Polizei sich zurückzog, während hunderte von Schaulustigen zusahen, Beifall klatschten und »Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!« skandierten. Wer allerdings glaubte, solche Aktionen blieben auf den Osten beschränkt, sah sich getäuscht. Zu traurigen Höhepunkten wurden Brandanschläge im November 1992 in Mölln und im Mai 1993 in Solingen, bei denen zehn türkische Menschen, darunter fünf Kinder, starben – beschämende Taten im wiedervereinigten Deutschland. Doch es gingen auch Millionen Menschen auf die Straße, demonstrierten Solidarität mit den ausländischen Mitbürgern und zeigten der Welt »das andere Deutschland«.
Auf dem Weg ins »Euroland«
Auch nach der Wiedervereinigung änderte sich nichts an den außenpolitischen Grundsätzen der Bundesrepublik. Im Vordergrund standen der europäische Einigungsprozess (mit besonderem Gewicht auf der deutsch-französischen Partnerschaft), die Beziehungen zu den USA und die von Willy Brandt begonnene Ostpolitik.
Helmut Kohl, der sich als »Enkel Adenauers« verstand, forcierte die »Europäisierung«. Er wollte den Nachbarn und der Welt damit auch signalisieren, dass sie vor dem wiedervereinigten Deutschland keine Angst zu haben brauchten. Ein »Viertes Reich«, das zuweilen als Gespenst durch die Medien in verschiedenen Ländern geisterte, würde es nicht geben.
Im Dezember 1991 beschlossen zwölf Staats- und Regierungschefs in Maastricht, die Europäische Gemeinschaft zur Europäischen Union weiterzuentwickeln. Die vor allem wirtschaftlich orientierte Gemeinschaft sollte sich schrittweise zu einer politischen Union entwickeln, der europäische Binnenmarkt sollte zu einer Wirtschaftsund Währungsunion mit einer Europäischen Zentralbank und einer gemeinsamen Währung ausgebaut werden. Dann wollte man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einleiten mit dem Ziel, irgendwann eine europäische Armee zu bilden. Auch in der Innen- und Rechtspolitik sollten Regelungen für eine engere Verzahnung geschaffen werden. Weil dies alles einen Verzicht auf Souveränitätsrechte und Selbstständigkeit bedeutete, gab es darüber in allen Ländern intensive Diskussionen. Doch bis auf Großbritannien stimmten schließlich alle Mitgliedstaaten den Maastrichter Verträgen zu. Im Grundsatz sind sich die Staaten also weitgehend einig: Am Ende des Prozesses sollen die Vereinigten Staaten von Europa stehen. Auf welchen Wegen und vor allem in welcher Zeit dieses Ziel angestrebt werden soll, darüber gibt es allerdings unterschiedliche Vorstellungen. Und noch scheuen sich die nationalen Regierungen und Parlamente, dem Europäischen Parlament und der Kommission, die eine Art europäische Regierung darstellt, weit reichende Kompetenzen zu geben; noch wollen sie, wenn auch abgestimmt mit den Partnern, selbst die Richtlinien ihrer Politik bestimmen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.