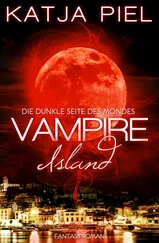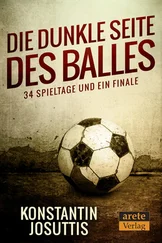Ich saß in Joes altem Lieblingssessel aus Leder, ein Erbstück von seinem Großvater Sergio. Annie und Zach kamen und kletterten auf meinen Schoß, schmiegten sich unter meinen Armen an mich, das Gewicht ihrer kleinen Körper wie perfekte Briefbeschwerer, um mich auf meinem Platz festzuhalten. Joes Bruder David rief immer wieder mit tränenerstickter Stimme vom Mobiltelefon aus an, denn er und Gil, sein Lebensgefährte, kamen nur schleichend auf dem Highway 101 voran.
Später, als die Kinder eingedöst waren, merkte David, dass ich mich auf der Toilette eingeschlossen hatte, und sagte durch die Tür hindurch: »Meine Liebe, machst du Pipi oder weinst du oder beides?«
Nichts davon. Ich hatte mich für ein paar Minuten weggestohlen und starrte mein Spiegelbild an, verwundert, dass alles in meinem Gesicht noch genauso war wie immer: Die Augen an der ihnen zugewiesenen Stelle über der Nase, der Mund darunter. Ich schloss die Tür auf, er kam herein und schloss sie wieder zu, stand da, die Arme seitlich am Körper, die Handflächen nach außen gedreht. Sein vom Schmerz gezeichnetes Gesicht war unrasiert und doch wie immer wunderschön. Er hatte das perfekt gemeißelte Antlitz und den wohlgeformten Körper einer römischen Statue, so dass er für seine Freunde nur »der David« war. Wir hielten uns in den Armen, und er flüsterte: »Was sollen wir nur ohne ihn machen?« Ich schüttelte den Kopf und tat nichts dagegen, dass meine Nase tropfte und seine Schulter nass wurde.
In dieser Nacht, mit einem schlafenden Kind in jedem Arm und Tränen, die mir in die Ohren liefen, fragte ich mich, wie wir das alles überstehen sollten. Doch dann machte ich mir bewusst, dass ich schon einmal ein großes Leid, das mich zu zerstören drohte, überlebt hatte.
Wenn ich heute an meine siebenjährige Ehe mit Henry zurückdenke, dann als an »die Jahre der Versuche«. Den Versuch, einen Felsbrocken den Berg hinaufzurollen. Den Versuch, Henrys träges Sperma in meinen Uterus zu befördern. Den Versuch, meine sturen Eier durch das Eileiterwirrwarr meines Unterleibs zu manövrieren. Die Anrufe bei Henry, er müsse dringend zum Mittagessen nach Hause kommen. Der schwierige Sex nach Plan. Und hinterher, auf dem Rücken liegend und die Füße in der Luft, der Versuch, Ei und Samen qua Willenskraft zusammenzuführen: Trefft euch . Kommt zusammen! Vereinigt euch! (An dem Punkt war ich überzeugt, dass meine Eier Schalen hatten, die schwer kaputtzukriegen waren.) Mein Wunsch nach einem Kind war so groß, dass er mich vollkommen beherrschte. Er nahm mich in Geiselhaft; meine Tage waren so dunkel und in sich verknotet wie die Vorstellung, die ich von meinem Uterus hatte: eine unheimliche, wenig einladende Höhle.
Dann war ich endlich schwanger.
Und verlor das Baby.
Ich lag auf dem Sofa, unter mir alte Handtücher, und hörte, wie Henry in der Küche die nötigen Anrufe machte, fühlte mich so unzulänglich, wie die entsprechende Terminologie es nahelegte. Ich hatte das Kind verloren – wie Schlüssel oder einen Perlmuttohrring. Oder Spontanabort , was klang, als hätten wir das Kind plötzlich nicht mehr gewollt und das einfach beschlossen. Und schließlich Fehlgeburt – eine Geburt, bei der mir ein Fehler unterlaufen war.
Weitermachen. Versuchen, schwanger zu werden, versuchen, schwanger zu bleiben. Versuche mit Spritzen, Gels, Pillen, Hoffnung, Euphorie, Bettruhe, mehr Bettruhe. Am Ende Verzweiflung.
Immer und immer wieder. Insgesamt fünfmal.
Und dann, eines Ostermorgens – während die Nachbarkinder in ihren neuen pastellfarbenen Kleidern auf den schmalen Rasenstreifen auf und ab liefen und ihre Körbchen mit Eiern füllten, die glockenklaren Stimmen voll süßer Freude und die Gesichter schokoladeverschmiert –, saßen Henry und ich an unserem langen, leeren Esstisch und beschlossen aufzugeben. Wir wollten nicht länger ein Kind bekommen und auch keine Ehe mehr führen. Henry war derjenige, der den Mut fand, die Worte auszusprechen: Es gab kein Wir mehr, nur noch die Obsession, und vielleicht war das der Grund, warum wir so hartnäckig am Kinderwunsch festgehalten hatten.
Damals schien es, als würde ich mein Leben lang traurig sein. Wie sollte ich auch wissen, dass das Universum nur sechs Monate später den Schalter umlegen würde? Ich war auf der kurvenreichen Straße – trefflich Bohemian Highway genannt – durch Sonoma County gefahren und hatte den Redwoods, die wie ein Begrüßungskomitee die Straße säumten, »Adieu, Bio-Tech Boulevard!« zugerufen. An der Brücke wartete ich, bis ein paar junge Typen mit Rastalocken und Gitarren die Straße überquerten, um runter zum Flussufer zu gelangen, und sie winkten, als hätten sie mich erwartet. Ich folgte dem Schild nach Elbow und hielt vor Capozzi’s Market. »Adieu, Tristesse in San Diego.«
Joe und ich waren gleich groß. Wir sahen die Welt auf die gleiche Weise und schmiegten uns so einfach in das Leben des anderen, wie Annies Hand sich an jenem Tag vor dem Laden in meine Hand geschmiegt hatte. Wir schliefen nicht an unserem ersten Date miteinander – so lange warteten wir nicht. Ich folgte ihm vom Parkplatz zu seinem Haus, half ihm beim Windelwechseln und Füttern des kleinen Zach, erzählte Annie eine Geschichte und gab den Kindern einen Gutenachtkuss, als machten wir das seit Jahren so. Keiner versicherte flüsternd dem anderen, dass er so etwas normalerweise nicht tue, das gestanden wir uns erst später ein. Doch tiefe Verletzungen bewirken manchmal eine gewisse Hemmungslosigkeit. Joe half, meinen Koffer ins Haus zu tragen, fand eine Vase für den Eimer voll Kornblumen – meine Centaurea cyanus , die auf dem Boden vor dem Beifahrersitz gestanden hatten und mir Glück bringen sollten. Wir redeten bis Mitternacht, und ich erfuhr, dass die Frau, deren Paisley-Morgenmantel noch immer am Haken der Badezimmertür hing, ihn vor vier Monaten verlassen hatte, dass ihr Name Paige war und sie seither nur einmal angerufen hatte, um sich nach Annie und Zach zu erkundigen. In unseren gemeinsamen Jahren danach rief sie nicht an. Kein einziges Mal. Wir liebten uns in Paiges und Joes Bett. Ja, es war hungriger Sex. Phantastischer hungriger Sex.
Aber jetzt liege ich im Bett und denke: Ich will nur die Zeit zurückdrehen, sonst nichts . »Wir wollen dich wiederhaben«, flüsterte ich, zog die Arme sacht unter Annies und Zachs schweren Köpfen weg und ging auf Zehenspitzen ins Bad. Da stand Joes Aftershave, Cedarwood Sage. Ich öffnete die Flasche und sog den Duft tief ein, tupfte es auf mein Handgelenk, hinter die Ohren, neben den Kloß in meinem Hals. Sein Rasierer. Ich fuhr mit dem Finger über die Klinge und beobachtete, wie sich eine feine, sich mit den Resten seiner Barthaare vermischende Blutlinie bildete.
Ich drehte den Hahn am Waschbecken auf, damit die Kinder mich nicht hörten. »Joe? Du musst unbedingt zurückkommen. Hör mir zu. Ich schaffe das nicht.« Die Monsterwelle war wie aus dem Nichts gekommen, und sie traf mich jetzt hier im Badezimmer. Ich bekam keine Luft, kämpfte gegen die tosende Kraft, die uns Joe entrissen hatte … Annies und Zachs Daddy. Schon einmal waren sie verlassen worden, von ihrer leiblichen Mutter. Wie viel konnten sie ertragen? Ich musste ihnen jetzt da durchhelfen. Doch gleichzeitig wusste ich, dass ihre bloße Existenz auch mich zusammenhalten und verhindern würde, dass ich zerbrach.
Ich trocknete mir das Gesicht, atmete ein paarmal tief durch und öffnete die Tür. Callie drückte ihre kalte schwarze Nase in meine Hand, drehte sich um und wedelte mir mit dem Schwanz um die Beine, leckte mein Gesicht, als ich mich hinunterbeugte und ihren Rücken tätschelte. Ich wollte für die Kinder da sein, wenn sie aufwachten, also ging ich zurück ins Bett und wartete auf die Morgendämmerung, auf den Moment, wenn sie erwachten.
Annie stand auf einem Stuhl und schlug Eier auf. Joes Mutter machte sich mit einer Sprühflasche über meinen Kühlschrank her, daneben war der Mülleimer, randvoll mit verdorbenen Lebensmitteln. Ich ging zu Annie und nahm sie von hinten in die Arme. Die Eidotter schwammen in der Schüssel, vier helle, makellose Sonnen. Sie machte sie mit dem Schneebesen kaputt und fing an, sie kräftig und konzentriert zu schlagen.
Читать дальше