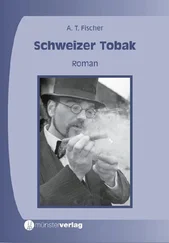«Ich weiss, auch das wäre eine Lösung. Ich habe vorher darüber nachgedacht, du darfst es mir glauben.»
Den Rest des Weges legten wir mehr oder weniger schweigend zurück. Waldemar machte keine Aufnahmen, und es wurde mir klar, dass seine ganze Ausrüstung nur zur Verschleierung seines wirklichen Anliegens gedient hatte. Wir trennten uns auf dem Parkplatz und sahen einander nie mehr.
Sein Tod genau eine Woche später war für mich ein ziemlicher Schlag, und er hat in mir alle Zweifel über das Leben meiner Eltern und insbesondere über meinen Vater ausgelöst. Später, nach ihrer Entlassung aus der Klinik, wollte ich mit meiner Schwester über die Jahre mit Waldemar sprechen, aber sie mochte nicht, nicht mit mir. Inzwischen war auch Norbert gestorben. Um mir ein Bild zu machen, blieb nur Bärbel, und die tat sich schwer.
Die Rös hatte Waldemar eröffnet, sie erwarte von Res ein Kind. Dann hatte sie ihn verlassen. Er holte seinen amerikanischen Colt, setzte sich unter einen blühenden Kirschbaum und schoss.
Dies alles hatte Yvonne von meiner Schwester erfahren – vielleicht auch viel mehr. Ich habe sie in der Klinik hin und wieder besucht. Sie sei als Borderliner schwierig zu therapieren. Man wisse darüber noch zu wenig. In Amerika versuche man, das Phänomen zu enträtseln. Später habe ich in dem Buch mit dem Titel «Ich hasse dich, verlass mich nicht» die wichtigsten Borderliner-Merkmale gefunden. Alles passte zu dem, was Waldemar mir erzählt hatte, die Stimmungsschwankungen, Zornausbrüche und Selbstmorddrohungen, die nie aufs Ganze gingen, sondern Erpressungen waren, die Gefühle der Bedrohung, der Leere, der gebrochenen Identität und krankhafte Eifersucht – und alles in Verbindung mit immer neuen, anfänglich überschwänglich erlebten zwischenmenschlichen Beziehungen, deren Scheitern von tiefer Depression und der Flucht in Alkohol oder Drogen begleitet ist.
Ich habe das Buch gelesen, um verstehen zu lernen, warum meine Schwester dieses schwierige Leben führen musste. Es war der Anfang meiner Rückschau auf mein eigenes und das Leben von Norbert und Bärbel.
Seit jenem Sonntag am See sind Jahre vergangen, aber Waldemars Erzählung konnte ich nie vergessen und ich habe mit niemandem ausser mit Erna darüber gesprochen. Meine Schwester lebt noch immer im Wallis, und ich glaube, einigermassen glücklich. Sie kam mit ihrer Freundin Yvonne zu Mutters Begräbnis. Wir haben miteinander kaum gesprochen, aber uns umarmt wie Geschwister es tun, wenn sie sich mögen.

Am Abend des Tages, an dem sich Waldemar unter einem blühenden Kirschbaum das Leben nahm, Bärbel Schneider ihren Sohn Rolf um Hilfe bat, Ilse Pfister in der Vergangenheit wühlte und Susanne Amrein einen eher traurigen Geburtstag verbrachte, war Jakob Amrein, Susannes Vater, nach der Heimkehr vom See schlechter Laune. Irgendwie hatte ihn der Selbstmord des Gretlersohnes unerwartet betroffen.
Nicht einmal fernsehen mochte er. Er kannte die Gretlers von zufälligen und flüchtigen Kontakten, ohne ihnen je näher gekommen zu sein. Lange, bevor er die Schmiede aufgegeben hatte, in den Jahren während und nach dem Krieg, als sein Vater noch lebte und es viele Pferde zum Beschlagen gab, kam manchmal eines der Kinder, ein Bub mit krausen Haaren, vermutlich dieser Waldemar, der Älteste, um etwaige Rossbollen, wie man den Pferdemist damals nannte, zu sammeln. Die Rosse entleerten sich oft, während sie vor der Schmiede auf ihre neuen Eisen warteten. Er liebte es überhaupt nicht, wenn da Kinder herumstanden oder gar rannten. Die Vorstellung, ein Tier könnte erschrecken und mit seinem Huf ein Kind treten oder gar erschlagen, war ihm entsetzlich. Es gab immer wieder Unfälle mit Pferden. Manchmal reagierten sie unverständlich störrisch, und dann konnten sie eine ungeheure Kraft entwickeln.
Aber jetzt, brütete Jakob vor sich hin, wo die Kavallerie abgeschafft war, gab es fast nur noch Luxuspferde. Die Bauern hatten Traktoren zum Ziehen der Wagen und Pflügen der Felder. Die Fuhrleute von damals nannten sich jetzt Camioneure, fuhren kleine und grosse Lastwagen. Nur die Brauerei hielt noch ein paar Gespanne – sie machten sich gut, als Werbeträger, sozusagen. Und die Wirte, zu denen sie die Fässer auf Brückenwagen brachten, nannten ihre Wirtschaften immer häufiger «Restaurant». Restaurant tönte moderner, liess höhere Preise zu. Die Lastwagen machten mehr Lärm, aber sie waren schneller und frassen, wenn sie in der Garage standen, kein Heu. So war eben der Rossmist von den Strassen verschwunden, und im Sommer gab es auch keine rauchenden und beissend stinkenden Kessel gegen die unersättlich Blut saugenden Bremsen mehr. Er war gewiss kein Weichling, aber manchmal taten ihm die Tiere Leid, und zudem hatte der Rauch aus dem Kessel an der Deichsel ihnen wenig geholfen, vielleicht sogar das Atmen erschwert, was kaum jemand bemerkt hätte. Seit die Pferde verschwunden waren, waren auch die Bremsen weg, wenigstens die fast fingergrossen und die grosse Menge.
Mehr und mehr hielten sich nur noch reiche Leute ein Pferd. Oder eben Pferdenarren, die versuchten, sich mit einem kleinen Gestüt wenigstens die Kosten zu decken, indem sie die Tiere ausmieteten an Hobbyreiter und vor allem an Mädchen, die die Rosse, vermutlich ohne es zu wissen, als eine Art erste Liebe erleben, mit einem Wesen, das sie zu meistern glaubten. Die oft noch kleinen Debütantinnen sahen niedlich aus, und waren sie schon ein bisschen grösser, sogar sehr hübsch da oben im hohen Sattel. Immer wieder aber packte ihn das Grauen, wenn er dachte, eines der Tiere könnte mit dem Kind wirklich durchbrennen. Die Leute hatten keine Ahnung, wie schnell das gehen konnte, dass aus dem Ritt ein Rasen wurde und die Zügel in den kleinen schwachen Händen wirkungslos blieben. Noch Glück hatte die kleine Reiterin, wenn sie schon früh vom Sattel fiel und nicht im Bügel hängen blieb, wenn sie nicht weggefegt wurde von einem Ast oder zerdrückt an einem Baumstamm oder einer Mauer.
Jakob verscheuchte die Bilder. Er hatte immer Respekt vor den starken Biestern gehabt. Er hatte Hunderte, wenn nicht Tausende beschlagen. Vor allem während des Krieges. Schon sein Vater hatte ihn vor ihnen gewarnt, obwohl sie für ihn tägliches Brot waren.
«Stell dich nie hinter sie», hatte er dem Buben immer wieder gesagt. Während Jakobs Lehre gab es einmal einen Unfall. Der Schlag war hart, der Oberschenkel des Bauern gebrochen, das glühende Eisen flog auf die Strasse. Wenigstens war das Pferd angebunden. Jakobs Vater war überzeugt, dass die Tiere oft ganz bewusst den Richtigen trafen. Sie vergässen Quälereien nie, und nicht alle Bauern seien tierliebend, auch Sonntagsreiter nicht, hatte ihm sein Vater eingebläut. Immer wieder erzählte er die Geschichte eines Jockeys, den sein Rennpferd im Stall an die Seitenwand gedrückt hatte, bis er tot war. Später zweifelte Jakob an ihrer Wahrheit. Vor allem, fand er, musste man sich hüten zu glauben, Pferde schlügen nur nach Schuldigen. Das war selbst bei den Menschen nicht so, war Jakob überzeugt.
Noch immer stand der Gretlerbub mit dem Wuschelkopf und seinem traurigen Gesicht, seinem Kessel und der kleinen Schaufel vor ihm, wie er nach Rossmist Ausschau hielt. Vielleicht war er sechs oder sieben. Er erinnerte sich, dass dessen Vater ihn gesucht hatte und ihm eine Ohrfeige gab. Das war nichts Besonderes. Ohrfeigen waren damals allseits als Mittel zur Erziehung anerkannt. Auch er hatte einige eingezogen und ausgeteilt. Man war nicht allzu zimperlich bei den Amreins. Aber gerecht mussten sie sein, und er hatte immer versucht, gerecht zu sein. Sein Vater und für schwierigere Fälle der biblische Salomon waren seine Vorbilder. Da hatte sich viel verändert in den letzten vielleicht zehn Jahren, dachte Jakob.
Читать дальше