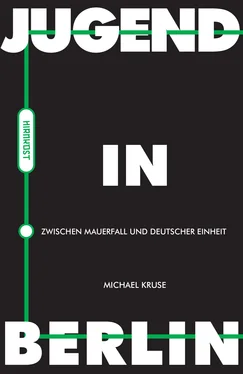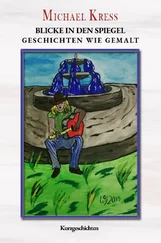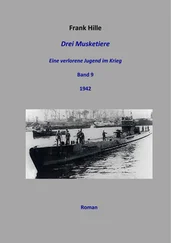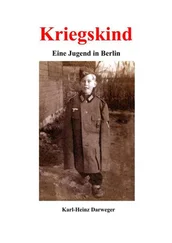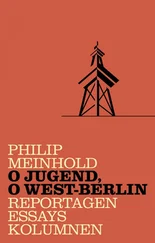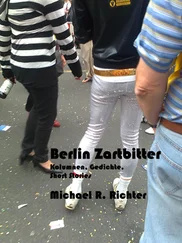Michael Kruse - Jugend in Berlin
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Kruse - Jugend in Berlin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Jugend in Berlin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Jugend in Berlin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Jugend in Berlin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Jugend in Berlin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Jugend in Berlin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Da Ostberlin bis zur Wende von mir als weißer Fleck wahrgenommen wurde, verbrachte ich die ersten Wochen nach der Grenzöffnung damit, den östlichen Teil Berlins, insbesondere Treptow, ausführlich kennenzulernen. Ich besuchte die wichtigsten Jugendclubs und unterhielt mich mit Jugendclubleitern und anderen Erwachsenen, um eine Einschätzung der allgemeinen Situation der Jugendlichen und der Strukturen der Jugendpolitik zu bekommen.
Die Interviews
Im Februar 1990 fanden die ersten Befragungen von Jugendlichen in Treptow statt. Insgesamt wurden 35 Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren befragt, 20 Mädchen und 15 Jungen. Zwei Drittel der Befragten kommen aus Ostberlin, ein Drittel der Befragten aus Westberlin, da sich im Laufe der Untersuchung herausstellte, dass sich für die Jugendlichen aus dem Ostteil der Stadt wesentlich mehr verändert hat als für die Jugendlichen aus Westberlin. Ende der 1990er Jahre wurden noch drei Wiederholungsinterviews geführt. Alle Interviews wurden in der Regel bei den Jugendlichen zu Hause durchgeführt. Die Dauer der Interviews betrug zwischen anderthalb und drei Stunden. Insgesamt wurden insgesamt ca. 800 Seiten ausgewertet. Drei Jugendliche wurden noch einmal interviewt, um so neuere Entwicklungen und Einschätzungen der Befragten festzuhalten. Alle Interviews wurden anonym durchgeführt, wobei die meisten Jugendlichen sehr offen ihre Situation schilderten. Sie geben deshalb einen tiefgehenden Einblick in die Gefühlslage der Berliner Jugend in den 1990er Jahren. Auch Klaus Farin und Eberhard Seidel betonen die Wichtigkeit, Jugendliche möglichst authentisch zu Wort kommen zu lassen (vgl. Farin/Seidel 2019: 9). Im Anschluss daran fanden oft noch Gespräche mit den Eltern statt, die eine gewisse Neugier hinsichtlich der Interviews erkennen ließen.
Aus der Zahl der Interviewten sollen beispielhaft zwei Personen kurz biografisch skizziert werden: Martina aus Ostberlin und Peter aus Westberlin. Martina, in Ostberlin geboren, schloss sich in ihrer Jugend der Gruftiszene der DDR an. In der Folge erhielt sie nicht nur Alex-Verbot, sie und ihre Eltern wurden auch von der Stasi regelmäßig überwacht. Der Vater blieb bei einem Westbesuch in Westberlin. Darauf stellte die Mutter einen Antrag auf Ausreise nach Westberlin, der überraschenderweise und kurzfristig genehmigt wurde. Die Ausreise 1987 über den S-Bahnhof Friedrichstraße war ein tiefer Einschnitt in das Leben der gesamten Familie. Martina kam relativ unvorbereitet im Westen an und fühlte sich Tag für Tag auf der Straße als Ostlerin erkannt. War sie früher in Ostberlin eher ein Ausgehtyp, so zog sie sich bis zur Wende völlig in die Familie zurück. Bei der Öffnung der Mauer traf sie ihre alten Freund*innen aus Ostberlin wieder und feierte mit ihnen an den früheren Jugendtreffpunkten. Nachdem die erste Neugier verflogen war, zog sie wieder in den Osten, traf sich gelegentlich mit früheren Freunden der Gruftiszene und gründete später eine Familie.
Peter dagegen wurde in einem bayrischen Dorf geboren. Auf Wunsch der Familie zogen sie nach Westberlin. Schnell freundete er sich mit vielen jungen Menschen an, obwohl ihm am Anfang sein bayrischer Dialekt beim Kennenlernen oft Schwierigkeiten bereitete. In der Folgezeit legte er sich eine größere Plattensammlung zu, damit er bei verschiedenen Veranstaltungen in Neukölln als DJ auftreten konnte. Den Osten kannte er nicht und hat ihn bis zur Wende, wie die meisten Westberliner Jugendlichen, nicht wahrgenommen. Den Mauerfall erlebte er nicht direkt als Bereicherung. Wirtschaftlich gesehen war es für ihn jedoch ein Glücksfall, da er nun auch im Osten bei größeren Feten als DJ auftreten konnte. Doch die jugendlichen Menschen im Osten blieben ihm fremd.
MEDIENSTADT BERLIN UND IHRE JUGENDLICHEN NUTZER*INNEN
Berlin ist die Medienmetropole Deutschlands. Zwei Trends zeichnen sich ab: Der Radiomarkt gilt als einer der härtesten in Europa, und in der vielfältigen Zeitungslandschaft ist bis heute ein Ost-West-Riss erkennbar. Dabei hat sich der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland relativ rasch und ohne lang anhaltende politische Diskussionen vollzogen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung über das neue Deutschland fand kaum statt, weil sie auch von der westlichen politischen Elite nicht gewünscht war. Die Organisationen im Westen haben Organisationen im Osten gegründet. Eigenständig im Osten gegründete Organisationen, soweit es sie denn überhaupt gab, blieben ohne relevanten politischen Einfluss. Und so mangelt es auch heute noch an einem eigenen ostdeutschen Mediensystem, das die Interessen der Menschen aus Ostdeutschland, insbesondere der Jugendlichen, vertritt und ihnen eine Stimme im wiedervereinigten Deutschland gibt. Zudem kam und kommt es aufgrund der Abwesenheit von bedeutsamen ostdeutschen Medien bzw. deren Abwicklung nicht zum Aufbau von ost-west-übergreifenden Informations- und Kommunikationsbeziehungen. In der Folge ist die wechselseitige Wahrnehmung und Aufmerksamkeit füreinander sehr einseitig. Auch auf der Rezipient*innenseite gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West, die im weiteren Verlauf medienspezifisch ausführlich dargestellt werden sollen, was zur Folge hat, dass sich beide Seiten nicht immer auf Augenhöhe begegnen.
Jugendzeit ist Medienzeit. Dabei taucht die 1999 vom Freizeitforscher Horst W. Opaschowski beschriebene Generation @ in eine Multimediawelt ein, die sie gleichzeitig durch die Kanäle zappen und zugleich telefonieren lässt, ein typisches Konsumverhalten der Generation der 1990er Jahre. Seit den 1950er Jahren ist die Mediennutzung, insbesondere das Radiohören, bei den Jugendlichen neben dem Ausgehen die wichtigste Freizeitbeschäftigung. Auch Jutta Gysi weist aus DDR-Sicht darauf hin, dass Fernsehen, Rundfunk- und Musikhören die beliebtesten Freizeittätigkeiten sind (vgl. Gysi 1989). Dazu betonen Günter Lange und Hans-Jörg Stiehler einen wichtigen Aspekt der DDR-Medien: „Es ist keine Zuspitzung, sondern eine realistische Zusammenfassung vielfältiger Untersuchungsergebnisse, festzustellen, dass im Verlauf der 80er Jahre die Medien zunehmend als eines der zentralen geistigen Vermittlungsglieder zwischen Gesellschaft und Individuum (bzw. Partei, Staat und Gesellschaft) ausfielen und zunehmend nicht nur dysfunktional, sondern selbst destabilisierend hinsichtlich ihrer (reproduktiven) Leistungen für Individuum und Gesellschaft wurden. In den 80er Jahren kam es bei Rundfunk und Fernsehen zu drastischen Verschiebungen in den Relationen zwischen DDR- und BRD-Medien. In gewisser Hinsicht vollzogen sowohl die Medien als auch das Publikum eine Entkopplung von Lebensalltag und Medienrealität“ (Lange/Stiehler in: Burkart 1990: 60). Und Bernd Lindner betont in seinem Beitrag Erst die neuen Medien, dann die neuen Verhältnisse: „Die Welt stand uns schon lange offen: durch die Medien. Vergleicht man die derzeitigen Umbrüche im politischen Bereich mit den Ergebnissen der jahrelangen soziologischen Forschungen im Bereich der Kultur-, Literatur- und Mediennutzung, so muss man feststellen, dass wir gerade dabei sind, das auf der gesellschaftlichen Ebene nachzuvollziehen, was wir alle im kulturellen Bereich schon mehr oder weniger gelebt haben. […] Diese Annährung der Jugenden beider ehemaliger deutscher Staaten an einen gemeinsamen Mediennutzungslevel ist keineswegs ein Ergebnis der letzten Jahre allein. Hier ist, insbesondere von den Jugendlichen der DDR – noch zu Zeiten, in denen deren Existenz scheinbar unerschütterbar schien – kräftig ‚vorgearbeitet‘ worden. Nirgendwo wird den Heranwachsenden daher der Anschluss an bundesrepublikanischen Alltag so einfach fallen wie im Medienbereich!“ (Lindner in: Hennig/Friedrich 1991: 99; 102).
Deutlich wird gerade im Medienbereich, wie sich die DDR und ihre Medienlandschaft seit der Wende für Jugendliche geändert hat: Intensiver Zugang zum Medienmarkt der Bundesrepublik Deutschland, erweitertes Medienangebot (Video, Computerspiele usw.), Kommerzialisierung des Medienmarktes und Erweiterung der audiovisuellen Kommunikation. Hier weist Bernd Lindner auf einen wichtigen Aspekt hin: „Die Medienzentriertheit des Freizeitverhaltens wird weiter zunehmen, schon weil auf diesem Gebiet das Gros der neuen Angebote erfolgen wird. Bisher in der DDR nur wenig verfügbare technische Geräte (wie Videorecorder und -kameras, CD-Player, Computer) wollen in ihren Möglichkeiten erkundet und ausgeschritten werden. Von einem ‚West-Schock‘ ist bei den DDR-Jugendlichen gegenwärtig nur wenig zu spüren, eher ein selbstverständliches Sich-Bedienen an den neuen Möglichkeiten“ (Lindner in: Friedrich/Griese 1991: 113). Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie Ost- und Westberliner Jugendliche die Medien nutzen, wo es Unterschiede und wo es Gemeinsamkeiten in der Rezeption gibt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Jugend in Berlin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Jugend in Berlin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Jugend in Berlin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.