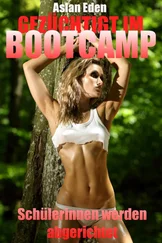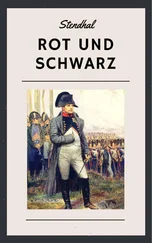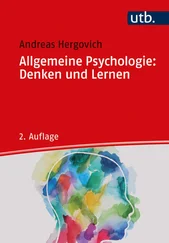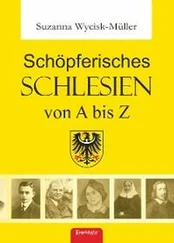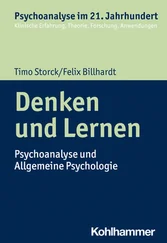Henri Bergson - Denken und schöpferisches Werden
Здесь есть возможность читать онлайн «Henri Bergson - Denken und schöpferisches Werden» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Denken und schöpferisches Werden
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Denken und schöpferisches Werden: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Denken und schöpferisches Werden»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
und Religionsphilosophie. Bergsons Einfluss reicht über die Philosophie hinaus auf die Existenzphilosophie und die Literatur. «Denken und schöpferisches Werden» erschien zuerst 1939 auf französisch, auf deutsch erstmals 1946. Es ist das letzte Buch Henri Bergsons, eine Bilanz seiner philosophischen Lebensarbeit, eine ausführliche Rechtfertigung seiner philosophischen Methode.
Denken und schöpferisches Werden — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Denken und schöpferisches Werden», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nehmen wir eine Farbe wie Orange. 3) Da wir außerdem noch Rot und Gelb kennen, können wir Orange in einem Sinn als gelb, im anderen als rot auffassen und sagen, daß es eine Zusammensetzung von Gelb und Rot ist. Aber nehmen wir einmal an, daß nur die Farbe Orange existierte, wie sie ist, und Gelb und Rot wären noch nicht in der Welt bekannt, — würde dann wohl Orange als aus jenen beiden Farben zusammengesetzt erscheinen? Offenbar nicht. Die Empfindung rot und die Empfindung gelb, die einen ganzen Mechanismus in den Nerven und im Gehirn in sich einschließen und zugleich ganz besondere Dispositionen des Bewußtseins, sind Schöpfungen des Lebens, die entstanden sind, aber die auch nicht hätten entstehen können — und wenn es weder auf unserem Planeten, noch auf irgend einem anderen Wesen gegeben hätte, die diese beiden Empfindungen gehabt hätten, dann wäre die Empfindung des Orange eine einfache unteilbare Empfindung gewesen; niemals wären in ihr als Komponenten oder als Aspekte die Empfindungen des Gelb und des Rot vorgestellt worden. Ich erkenne an, daß unsere gewöhnliche Logik protestiert. Diese sagt: „Da nun einmal die Empfindungen gelb und rot heute als Zusammensetzung in die des Orange eingehen, gingen sie immer darin ein, selbst wenn es eine Zeit gegeben hat, wo keine der beiden wirklich existierte, sie waren dann virtuell darin vorhanden.“ Aber das zeigt eben, daß unsere gewöhnliche Logik eine retrospektive Logik ist. Sie kann es nicht lassen, in die Vergangenheit als sog. Möglichkeiten oder Virtualitäten die gegenwärtigen Wirklichkeiten zurückzuprojizieren, so daß dasjenige, was jetzt in ihren Augen zusammengesetzt ist, es auch immer gewesen sein soll. Sie gibt nicht zu, daß ein einfacher unteilbarer Zustand, wenn auch sich selbst gleichbleibend, ein zusammengesetzter Zustand werden kann und zwar allein dadurch, daß die Entwicklung neue Gesichtspunkte schafft, in die man ihn geistig auflösen kann. Sie will nicht glauben, daß, wenn diese Elemente nicht als Wirklichkeiten aufgetaucht wären, sie auch nicht vorher als Möglichkeiten existiert hätten, da die Möglichkeit einer Sache nur immer die Spiegelung der einmal aufgetauchten Wirklichkeit in eine unbestimmte Vergangenheit bedeutet (außer dem Fall, wo diese Sache nur eine ganz mechanische Gruppierung präexistierender Elemente ist). Wenn sie unter der Form des Möglichen alles, was in der Gegenwart an Wirklichkeit auftaucht, in die Vergangenheit zurückschiebt, so liegt das daran, daß sie nicht zugeben will, daß irgend etwas neu auftaucht, daß irgend etwas geschaffen wird, daß die Zeit eine wirksame Kraft ist. In einer neuen Form oder einer neuen Qualität sieht sie nur eine Neugruppierung alter Elemente, niemals etwas absolut Neues. Jede Vielheit löst sich für sie in eine bestimmte Anzahl von Einheiten auf. Sie erkennt nicht die Idee einer unbestimmten Vielheit oder gar einer ungeteilten Vielheit an, die rein intensiver oder qualitativer Art ist, die eine unbegrenzt wachsende Zahl von Elementen in sich einschließt in demselben Maße, wie in der Welt die neuen Gesichtspunkte auftauchen, von denen aus man sie betrachten kann, Es kommt sicherlich nicht in Frage, auf diese Logik zu verzichten, noch auch sich gegen sie zu empören, aber man muß sie erweitern, geschmeidiger machen und einer Dauer anpassen, in der das Neue unaufhörlich hervorsprudelt, und die Entwicklung eine schöpferische ist.
Das war vorzüglich die Richtung, die wir einschlugen. Viele andere eröffneten sich vor uns und um uns herum von dem Zentrum aus, in dem wir unseren Standpunkt genommen hatten, um die reine Dauer wieder zu erfassen. Aber wir schlugen diese Richtung vorzugsweise ein, weil wir, um unsere Methode zu erproben, als erstes das Problem der Freiheit gewählt hatten. Gerade dadurch versetzten wir uns ganz in den Fluß des inneren Lebens, von dem die Philosophie uns zu oft bloß die erstarrte Oberfläche festzuhalten schien. Waren der Romanschreiber und der Moralist in dieser Richtung nicht viel weiter vorgedrungen als der Philosoph? Vielleicht — aber nur gelegentlich unter dem Druck der Not hatten jene das Hindernis genommen. Keinem war es noch eingefallen, methodisch „auf die Suche nach der verlorenen Zeit“ zu gehen. Wie dem auch sei, wir gaben in dieser Hinsicht in unserem ersten Buch nur Andeutungen, und wir beschränkten uns im zweiten noch auf Anspielungen, als wir den Plan de l’action — in dem die Vergangenheit sich in der Gegenwart zusammenzieht — verglichen mit dem Plan du rêve, in dem sich die Totalität der Vergangenheit unteilbar und unzerstörbar entfaltet. Aber wenn auch das Studium der Seele in concreto an individuellen Beispielen Sache der Literatur ist, so schien uns doch die Aufgabe der Philosophie zu sein, hier die allgemeinen Bedingungen der direkten unmittelbaren Selbstbeobachtung festzustellen. Diese innere Beobachtung wird durch die Denkgewohnheiten, die wir angenommen haben, verfälscht. Die hauptsächlichste Entstellung ist ohne Zweifel diejenige, die das Problem der Freiheit geschaffen hat, ein Pseudoproblem, das aus einer Verwechslung der wahren Dauer mit dem Raum entstanden ist. Aber es gibt noch andere, die denselben Ursprung zu haben scheinen: unsere Seelenzustände scheinen uns zählbar, diese oder jene unter ihnen sollen, in dieser Weise dissoziiert, eine meßbare Intensität haben, jedem von ihnen glauben wir die Worte substituieren zu können, die sie bezeichnen, und die sie dann überdecken, wir schreiben ihnen dann die Festigkeit, die Diskontinuität, die Allgemeinheit der Worte selber zu. Diese Hülle gilt es zu erfassen, um sie zu zerreißen. Aber man wird sie nur erfassen, wenn man zuerst ihre Gestalt und Struktur untersucht, wenn man auch ihre Bestimmung versteht. Sie ist von Natur räumlich, und sie hat eine soziale Bedeutung. Die Räumlichkeit also und in diesem ganz besonderen Sinn auch die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens sind hier die wahren Ursachen für die Relativität unserer Erkenntnis. Wenn wir diesen trennenden Schleier entfernen, dann kehren wir zum Unmittelbaren zurück und berühren ein Absolutes, ein Unbedingtes.
Aus diesen ersten Überlegungen gingen Schlußfolgerungen hervor, die glücklicherweise fast banal geworden sind, aber die damals kühn erschienen. Sie forderten den Bruch mit der Assoziations-Psychologie, die, wenn auch nicht als Lehre, so doch als Methode, damals allgemein anerkannt war. Sie verlangten noch einen weiteren Bruch, den wir nur erst andeuteten. Neben der Assoziations-Psychologie gab es den Kantianismus, dessen Einfluß übrigens, oft mit der ersteren verbunden, nicht weniger mächtig und nicht weniger allgemein war. Diejenigen, die den Positivismus eines Comte, oder den Agnostizismus eines Spencer zurückwiesen, wagten nicht, die kantische Auffassung von der Relativität der Erkenntnis zu bestreiten. Kant hatte, so sagte man, bewiesen, daß unser Denken eine Materie bearbeitet, die von vornherein in Raum und Zeit zerstreut ist, und die so ganz speziell auf den Menschen zugeschnitten ist: das sog. „Ding an sich“ entschlüpft uns; um dieses zu erfassen, bedürfte es einer intuitiven Erkenntnisfähigkeit, die wir nicht besitzen. Ganz im Gegensatz dazu ging aus unserer Analyse hervor, daß wenigstens ein Teil der Wirklichkeit, nämlich unsere Person, in ihrer ursprünglichen Reinheit erfaßt werden kann. Hier ist das Material unserer Erkenntnis nicht geschaffen und gleichsam zerbröckelt und entstellt durch eine Art von boshaftem Geist, der danach einen Haufen atomisierter Empfindungen unserem Bewußtsein zu einer künstlichen Synthese dargeboten hätte. Unsere Person erscheint uns, so wie sie ist, in ihrem „An-sich“, sobald wir uns von Denkgewohnheiten freimachen, die wir aus Bequemlichkeit angenommen haben. Aber sollte es nicht ebenso bei anderen Wirklichkeiten sein, vielleicht gar bei jeder? War die „Relativität der Erkenntnis“, die jeden Aufschwung der Metaphysik verhinderte, ursprünglicher und wesentlicher Art? Sollte sie nicht vielmehr zufälliger Art sein und auf einer erworbenen Denkgewohnheit beruhen? Sollte sie nicht ganz einfach daher rühren, daß die Intelligenz Vorstellungsgewohnheiten angenommen hat, die für das praktische Leben notwendig sind: diese Gewohnheiten, auf das Gebiet der Spekulation übertragen, stellen uns einer entstellten und umgemodelten Wirklichkeit gegenüber, die konstruiert ist; aber die Konstruktion zwingt sich uns nicht unausweichbar auf, sie rührt von uns selbst her; was wir selbst gemacht haben, können wir auch wieder auflösen, und dann treten wir in direkten Kontakt mit der Wirklichkeit. Es war also nicht nur die psychologische Theorie des Assoziationismus, die wir beiseite schoben, es war auch, und aus einem analogen Grund, eine allgemeine Philosophie, wie etwa der Kantianismus und alles, was sich damit verband. Beide, die damals in ihren großen Zügen anerkannt waren, erschienen uns als impedimenta, die die Philosophie und die Psychologie am Fortschritt hinderten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Denken und schöpferisches Werden»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Denken und schöpferisches Werden» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Denken und schöpferisches Werden» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.