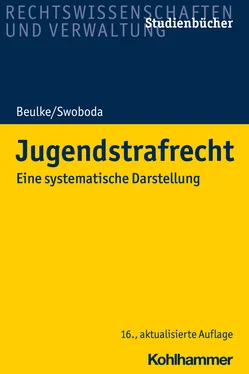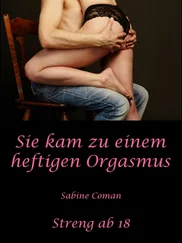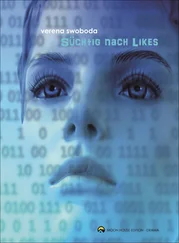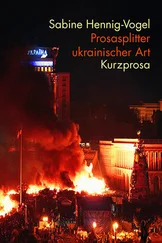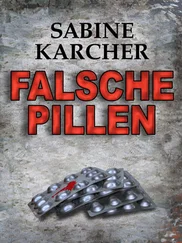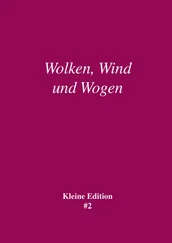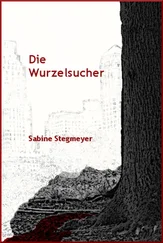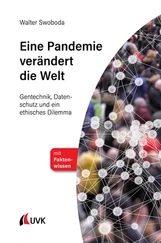105Das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943 183brachte auf der Grundlage der durch die Verordnungen vom 4.10.1940 und vom 10.9.1941 geschaffenen Neuerungen eine Umgestaltung des gesamten Jugendstrafrechts. Es beruhte in seinem materiell-rechtlichen Teil auf der Dreigliederung der Rechtsfolgen der Jugendstraftat in Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendgefängnis. Der Jugendarrest als wichtigstes Zuchtmittel sollte die kurzzeitige Freiheitsstrafe ersetzen. Seine Einführung machte die Begrenzung des Mindestmaßes der echten Freiheitsstrafe auf zunächst 3 Monate möglich. Durch die Bezeichnung dieser einzigen gegen Jugendliche zulässigen Kriminalstrafe als „Jugendgefängnis“ wurde diese auch äußerlich gegenüber den Freiheitsstrafen des Erwachsenenrechts abgehoben. Ihre innere Eigenständigkeit kam in der Beseitigung der für das allgemeine Strafrecht geltenden Strafrahmen, in den Vorschriften über Vollstreckung und Vollzug sowie in der Zulässigkeit der unbestimmten Strafdauer zum Ausdruck. Auch die weitere erzieherische Ausgestaltung der Jugendstrafe und die Einführung der „Beseitigung des Strafmakels durch Richterspruch“ sind als wesentliche Neuerungen und Fortschritt zu nennen. Zu den Rückschritten, die das RJGG vom 6.11.1943 mit sich brachte, zählen ansonsten die völlige Beseitigung der Strafaussetzung zur Bewährung, ferner die mit dem RJGG von 1943 verfügte „Auflockerung“ der Altersgrenzen in § 3 II S. 2 RJGG, die es ermöglichte, in schweren Fällen auch Kinder über 12 Jahre zu bestrafen, „wenn der Schutz des Volkes wegen der Schwere der Verfehlung eine strafrechtliche Ahndung fordert“, und andererseits die Möglichkeit, auf „frühreife Personen“, die in ihrer Entwicklung einem über 18-Jährigen gleichstellt werden konnten (§ 20 I RJGG von 1943) und auf „charakterlich abartige Schwerverbrecher“ unter 18 Jahren (§ 20 II RJGG von 1943) Erwachsenenstrafrecht anzuwenden. 184Die schon damals beabsichtigte Einbeziehung der „Heranwachsenden“ in das Jugendstrafrecht musste mit Rücksicht auf Krieg und Wehrdienst unterbleiben. Gem. § 1 II S. 1 RJGG von 1943 wurde das RJGG zudem zum „Deutschenstrafrecht“ erklärt. Auf andere (gemeint waren die sog. „Fremdvölkischen“ „artverwandten Blutes“; RiLi zu § 1 II RJGG von 1943) war das Gesetz allenfalls noch sinngemäß anwendbar (§ 1 II S. 2 RJGG). Ansonsten waren Ausländer der Willkür der Polizei oder des NS-Kriegsstrafrechts überantwortet. 185
3.Kontinuität im Jugendgerichtsgesetz von 1953
106Demgegenüber entwickelte das in der Bundesrepublik eingeführte Jugendgerichtsgesetz vom 4.8.1953das JGG 1943 weiter fort, nachdem dessen nationalsozialistische Elemente, insbesondere die erwähnte „Auflockerung“ der Altersgrenzen, schon vorher durch die Praxis beseitigt worden waren. 186Namentlich in zwei Punkten gelang 1953 eine weitere Verbesserung: Der wieder eingeführten Strafaussetzung zur Bewährung wurde durch strengere Bestimmung ihrer Voraussetzungen und durch die Einrichtung der Bewährungshilfe und -aufsicht nach englischem Muster ein gewisser Schutz gegen die Missstände gegeben, die während der Geltung des JGG 1923 ihre Anwendung diskreditiert hatten. Noch wesentlicher war, dass nunmehr auch die „Heranwachsenden“ bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, freilich nur teilweise und allzu verklausuliert, in das Jugendstrafrecht einbezogen wurden. Aus der NS-Zeit verblieben ist demgegenüber die, allerdings auch schon zu Zeiten der Weimarer Republik geforderte, Sanktionskategorie der „Zuchtmittel“ mit dem Institut des Jugendarrests und das Prinzip „Erziehung durch Strafe“, das die Jugendstrafe als letztes wirksames Erziehungsmittel begreift und mit diesem Verständnis in § 17 II JGG gesetzlich Ausdruck gefunden hat.
107Obwohl gerade die Regelung des wichtigen Heranwachsenden-Problems noch der Verbesserung und Vereinfachung bedarf, hat doch insgesamt der Gesetzgeber mit dem JGG 1953 besonders sorgfältige und wertvolle Arbeit geleistet. Vergleichen wir den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung mit den Anfängen der Jugendgerichtsbewegung, so ist vieles von dem, was zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts als revolutionäres Programm einer kleinen Gruppe erschien, inzwischen in die Wirklichkeit umgesetzt, ja sogar zum selbstverständlichen Bestandteil des allgemeinen Rechtsbewusstseins geworden. Dennoch darf der reformatorische Eifer in Bezug auf das Jugendstrafrecht nicht erlöschen. Deshalb beziehen sich die vordringlichsten Forderungen der Jugendgerichtsbewegung bis heute auf die Auswahl und Ausbildung der Jugendrichter und auf die finanzielle und personelle Ausstattung der Vollzugseinrichtungen, namentlich des Jugendstrafvollzugs und der Untersuchungshaft bei Jugendlichen. Auch der Standardsicherung der überlasteten Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe kommt besondere Bedeutung zu. Neben den traditionellen Sanktionen sind auch weiterhin neue, alternative Reaktionsformen auf Jugendstraftaten zu entwickeln, die ein intensives Eingehen auf die spezielle Konfliktsituation des Einzelnen ermöglichen und eine Stigmatisierung des Jugendlichen vermeiden. So manches Thema des Jugendstrafrechts ist bis heute von internationaler Aktualität, etwa das Verhältnis von Jugendstrafe zu Jugendhilfe, die Frage der Altersgrenzen und die Rolle einer opferorientierten Verfahrensgestaltung sowie die Ausgestaltung der sog. „restorative justice“. 187
III.Reformbemühungen in der Gesetzgebung
108Über die Verbesserungen in Einzelfragen hinaus wird seit mehreren Jahrzehnten auch die grundsätzliche Linie des deutschen Jugendstrafrechts diskutiert. Der Kompromiss zwischen Erziehung und Strafe, auf dem das geltende Recht beruht, ist auch vor dem Hintergrund der Diskussion um die wirksamsten Wege zur Bekämpfung von Jugendkriminalität umstritten geblieben.
109Das äußert sich nicht nur an den bereits erwähnten neuralgischen Punkten, wie etwa dem Jugendarrest und dem Jugendstrafvollzug, sondern auch in der unbefriedigenden Zumessungspraxis der Jugendstrafe. Deren Dauer wird oft durch das an der Tatschwere orientierte „Straftaxendenken“ des Erwachsenenstrafrechts geprägt, von dem sich viele Jugendrichter und -staatsanwälte nicht lösen können. Die erzieherischen Bedürfnisse des Täters stehen entgegen der gesetzlichen Zielsetzung § 2 I JGG hinter dem Straftaxenansatz zurück. 188Deshalb hat es stets Stimmen gegeben, die in Anknüpfung an schon in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte Gedankengänge die Kriminalstrafe aus dem Jugendrecht völlig ausscheiden und dieses in ein reines Erziehungsrecht umwandeln wollen. In ihm wäre auf alle Formen sozialer Gefährdung Jugendlicher, mögen sie sich in Kriminalität oder in sonstiger sozialer Auffälligkeit äußern, unterschiedslos mit einem System individualisierender sozialpädagogischer-medizinischer-psychotherapeutischer Behandlungsmethoden zu antworten. In diese Richtung wiesen neben dem Grundsatzreferat von Karl Peters auf dem Jugendgerichtstag in Münster 1965 189etwa die Vorschläge für ein „erweitertes Jugendhilferecht“, die von der Jugendrechtskommission der Arbeiterwohlfahrt1970 vorgelegt worden sind. 190Diesen Bestrebungen waren trotz verschiedener gesetzgeberischer Anläufe in der Zeit der sozialliberalen Koalition der Siebzigerjahre jedoch kein Erfolg beschieden. Vielmehr wurden in den gesetzgeberischen Vorarbeiten im „Diskussionsentwurf“einer im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit eingesetzten Sachverständigenkommission (1973) die Schwierigkeiten deutlich, welche die Durchführung einer solchen Konzeption bereitet. 191Gerade Sozialpädagogen neigen in ihren Vorschlägen für eine Erweiterung des Jugendhilferechts auf Kosten des Jugendstrafrechts, defizitorientiert zu handeln. Sie orientieren den von ihnen bevorzugten Katalog individueller Erziehungshilfen an dem Bild des entwicklungsgestörten, sozial gefährdeten und eben deshalb erziehungsbedürftigen Jugendlichen und übersehen dabei die durch die moderne Dunkelfeldforschung erwiesene Tatsache der „Normalität“ und „Ubiquität“ der kleineren Jugendkriminalität. 192Man wird daher über manche geringfügigen Jugendvergehen sanktionslos hinweggehen können. Andererseits gibt es auch Taten, die sowohl im Interesse der Rechtsordnung als auch im Interesse der Entwicklung des Jugendlichen selbst nicht ungeahndet bleiben können, ohne dass deswegen gleich intensive und einschneidende Erziehungshilfen erforderlich wären. Hier liegt die Funktion jener Sanktionen, die das geltende JGG als Zuchtmittel umschreibt (darüber näher Rn. 387 ff.). Gemeint sind kurzfristige Maßnahmen, die den Täter auch ohne eine umfangreiche pädagogische Hilfestellung in ausreichendem Maße positiv beeinflussen sollen.
Читать дальше