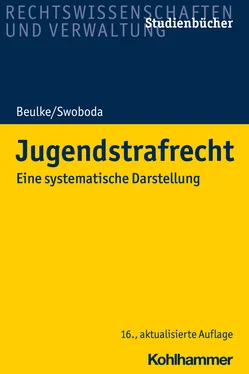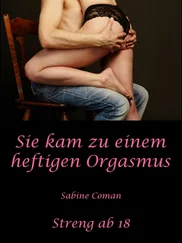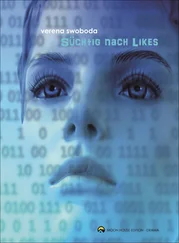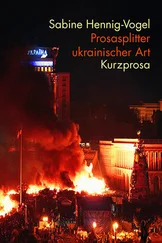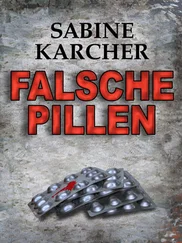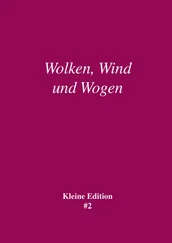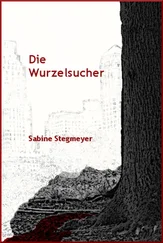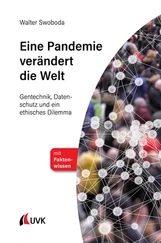§ 5Die Jugendgerichtsgesetze von 1923, 1943 und 1953. Reformbestrebungen
I.Die jugendstrafrechtlichen Entwicklungsleitlinien seit 1923
99 Versuchen wir rückschauend die Entwicklung der jugendstrafrechtlichen Gesetzgebung, die mit dem JGG 1923 ihren Anfang nahm und sich in den beiden JGG von 1943 und 1953 fortsetzte, in den geschichtlichen Gesamtzusammenhang einzuordnen, so wird auf diesem Teilgebiet der Rechtsordnung besonders die Wandlung des bürgerlichen Rechtsstaats des 19. Jahrhunderts zum Sozialstaat der modernen industriellen Gesellschaft deutlich.
100Über die Wahrung des Rechts hinaus wird hier die Strafjustiz mit sozialpädagogischen Aufgaben betraut; ihre Entscheidungen werden stärker von außerrechtlichen, oft nur durch Sachverständige zu vermittelnden Gesichtspunkten abhängig gemacht; Jugendgerichtshilfe und Bewährungshilfe werden als mit der Rechtsprechung verbundene Organe der sozialen Fürsorge geschaffen, ja sogar dem Richter selbst in Verhandlung, Urteil und Vollstreckung erzieherische Funktionen zugewiesen. 170Der weite Ermessensspielraum, den ihm das Gesetz zu diesem Zweck gewährt, erfordert für seine richtige Ausfüllung mehr kriminalpolitische und kriminologische Einsicht als eine das allgemeine Strafrecht kennzeichnende formale Strenge der rechtsdogmatischen Begriffsbildung. Denn ihre besonderen Ziele kann die jugendstrafrechtliche Gesetzgebung nicht ohne eine gewisse Einbuße an dem überlieferten rechtsstaatlichen Schutz der Individualsphäre erreichen. Die damit angedeutete Spannung wird uns später in der Darstellung der Einzelfragen des geltenden Rechts immer wieder begegnen.
II.Die Jugendgerichtsgesetze
101Die deutsche Gesetzgebung hat den wohlfahrtsstaatlichen Tendenzen nicht so weit nachgegeben, wie dies vielfach in der internationalen Diskussion gefordert und in manchen ausländischen Rechtsordnungen auch durchgesetzt worden ist. Vielmehr haben die deutschen Jugendgerichtsgesetze einer mittleren Lösung den Vorzug gegeben, indem sie zwar einerseits die Jugendgerichtsbarkeit durch die stärkere Einfügung sozialpädagogischer Elemente von der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit abhoben, aber andererseits nicht auf die Ahndung schuldhafter Tat durch sühnende Strafe und die in einem förmlichen Strafgerichtsverfahren liegenden Freiheitsgarantien völlig verzichteten.
102Schon das JGG 1923leitete diese Entwicklung ein. Es ersetzte die veralteten §§ 55 bis 57 RGStGB und erfüllte viele Forderungen der Jugendgerichtsbewegung. Kinder von 12 und 13 Jahren blieben nunmehr straffrei (gem. § 2 JGG 1923) und für die Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren wurden die Strafen durch ein System jugendrichterlicher Erziehungsmaßnahmen ergänzt. Bestrafung, die fortan neben der geistigen auch die sittliche Reife voraussetzte, durfte nach einem neu eingeführten Subsidiaritätsprinzip nur dann erfolgen, wenn Erziehungsmaßregeln nicht ausreichten. Überdies konnte die Vollstreckung der Strafe vom Richter auf Probe ausgesetzt werden. Für die Aburteilung der Jugendlichen waren die nunmehr legalisierten Jugendgerichte zuständig. Auch das Verfahren vor den Jugendgerichten wurde in Abweichung vom allgemeinen Strafverfahren den besonderen pädagogischen Erfordernissen angepasst, so etwa durch den Ausschluss der Öffentlichkeit, erhebliche Einschränkungen des Legalitätsprinzips und dergleichen. Die Aufgabe der Persönlichkeitserforschung und die fürsorgerische Betreuung der straffälligen Jugendlichen fielen der primär dem Jugendamt übertragenen „Jugendgerichtshilfe“ zu.
103Obwohl das JGG 1923 nach dem damaligen Entwicklungsstand ein fortschrittliches Gesetz war, wies es doch manche Mängel und Lücken auf, die sich bei seiner praktischen Anwendung bald bemerkbar machten. 171Da es – entgegen der schon von Appelius erhobenen Forderung – keine Begrenzung des Mindestmaßes der Freiheitsstrafe kannte, gelang es nicht, die schädlichen kurzzeitigen Freiheitsstrafen auszumerzen. Sie wurden vielmehr trotz aller Warnungen auch weiterhin in erschreckend hohem Ausmaße verhängt. Auch fehlte bei der von der Praxis allzu oft angewendeten Strafaussetzung zur Bewährung eine Einrichtung, die ähnlich der angelsächsischen „probation“ eine wirksame erzieherische Betreuung der Probanden während der Bewährungszeit gewährleistet hätte. Diese Lücken des Gesetzes traten besonders stark hervor, als während der Wirtschaftskrise der Jahre 1930 bis 1933 infolge der Arbeitslosigkeit und der mit ihr verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Not die Jugendkriminalität einen neuen Höhepunkt erreichte. 172
2.Die Zeit des Dritten Reichs und das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943
104Die Weiterentwicklung auf dem Gebiet des Jugendstrafrechts wurde in den Jahren von 1933 bis 1945 einerseits durch die Fehlentwicklungen beeinträchtigt, die das gesamte Strafrecht der NS-Zeit betrafen, andererseits gelang es während des Krieges, alte Ziele der Jugendgerichtsbewegung zu verwirklichen. Dies nun jedoch unter den falschen ideologischen Vorzeichen, so dass aus ursprünglich erzieherisch intendierten Projekten der Jugendgerichtsbewegung im Zusammenspiel mit der nationalsozialistischen Unrechtsordnung und der NS-Ehr- und Rassenideologie neue Straf- und Unterdrückungsmechanismen zulasten der nicht NS-systemkonform parierenden Jugendlichen entstanden. 173Die Verordnungen vom 4.10.1940 und vom 10.9.1941 führten den Jugendarrest und die Jugendgefängnisstrafe von unbestimmter Dauer ein. Dabei zeigte sich insbesondere der Jugendarrest als willfähriges Instrument zur Unterdrückung und gewaltsamen Vereinnahmung der nicht mit der NS-Ideologie und ihren Anforderungen an die Mitglieder der Volksgemeinschaft konform gehenden jungen Menschen. Der neue Jugendarrest konnte durch die Gerichte und, ganz im Sinne des nationalsozialistischen Ziels, seinen Polizeikräften schrankenlose Gewalt auch auf dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung einzuräumen, unmittelbar durch die Polizei verhängt werden (§ 52 JGG 1943). 174Die Notwendigkeit dieser neuen Erziehungs-, Ehren- oder Schockstrafe 175wurde einerseits damit begründet, dass es bei manchen erziehungsgeeigneten jungen Tätern sinnvoll sei, die negativen Wirkungen und den Makel der Jugendstrafe, insbesondere den Makel des Vorbestraftseins, zu meiden. 176Andererseits diente die Einführung des Jugendarrests aber auch dazu, eine für die nationalsozialistische Rechtsauslegung typische Umwertung der Jugendstrafe vornehmen zu können, von einer ideologisch neutralen Sanktionen in eine „Ehrenstrafe“ mit Auslesefunktion, deren Verhängung allein bereits offenbare, dass der Betroffene nicht resozialisiert und damit auch nicht mehr in die deutsche Volksgemeinschaft integriert werden könne. 177Der betroffene Jugendliche müsse aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder zur Sicherheit der Allgemeinheit in „Schutz- und Konzentrationslagern“ verwahrt werden. 178Als Erziehungs-, Ehren- oder Schockstrafe sollte der Jugendarrest die erzieherischen Maßnahmen des JGG nicht nur ergänzen, sondern nach der Idee Freislers sogar den Raum wesentlich beherrschen, den bis dahin die Erziehungsmaßnahmen behauptet hatten. 179Der Jugendarrest sollte sich, ganz im Sinne der NS-Weltanschauung, nur auf „gutgeartete“, d. h. weltanschaulich für die NS-Ideologie zugängliche Jugendliche 180konzentrieren, während die Jugendstrafe für die „Unerziehbaren“, die aus „volkshygienischen“ oder „rassenbiologischen“ Gründen 181aus der Gemeinschaft auszuschließenden jugendlichen Straftäter vorbehalten bleiben sollte. Neben Polizei und Jugendgerichten erhielt auch die Hitlerjugend (HJ) eine Befugnis zur Bekämpfung von Straftaten im Rahmen ihres internen Disziplinarrechts. Die HJ konnte sich zudem am Jugendstrafverfahren beteiligen und die Durchführung der „Schutzaufsicht“ als jugendgerichtlich angeordnete Erziehungsmaßregel übernehmen. 182
Читать дальше