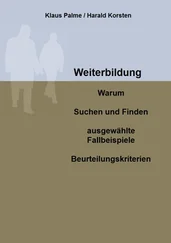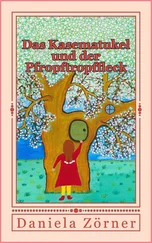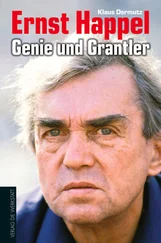Innerhalb dieses beiden Wissenschaften gemeinsamen Rahmens ist unsere Untersuchung notwendig, wenn immer es stimmt, daß »das gesellschaftliche Selbstverständnis der Wissenschaft [...] im Begriff der Wissenschaft selbst als Forderung enthalten« 14 ist, und sie hat ihr Wahrheitskriterium am dialektischen Begriff von Aufklärung.
Inwieweit haben nun die neueren historisch-theoretischen Darstellungen der Psychiatrie sich mit den hier beschriebenen Aufgaben beschäftigt? Diese Frage steht im Mittelpunkt des ersten Abschnitts des Anhangs. 15 Die Ausbeute ist gering, obschon seit 1969, dem Erscheinen der 1. Auflage dieses Buches, erfreulicherweise größer geworden. Es folgt daraus, daß unsere Untersuchung vorwiegend deskriptiv-historisch vorgehen, psychiatrisches Denken und Handeln und deren Zusammenhang erst ausbreiten und bekanntmachen muß. Außerdem ergibt sich daraus, welche Aspekte der Psychiatrie ausgeblendet, einseitig dargestellt oder ideologisch nicht mit ihrem eigenen Anspruch konfrontiert worden sind, woran umgekehrt deutlich wird, in welcher erweiterten (oder auch beschränkenden) Weise der Gegenstand unserer Untersuchung zu sehen und zu reflektieren ist.
Daß die Kritik des naturwissenschaftlichen Selbstverständnisses der Psychiatrie nur da berechtigt ist, wo es ideologisch zur Absicherung theoretischer Meinungen und politischer Ziele mißbraucht wird, ist bereits gesagt worden. Die anthropologische Fundierung der Psychiatrie, namentlich der frühen Nachkriegszeit, ist leider mehr oder weniger folgenlos geblieben, zugunsten einer insgesamt technokratisch verkürzten Wahrnehmung psychischen Leidens. Diesen anthropologischen Denkansatz aufzugreifen und zu beerben steht noch bevor. Erst dann wäre die Abgrenzung zwischen dem, was naturwissenschaftlich zu erklären, und dem, was geisteswissenschaftlich zu verstehen ist, möglich. Dasselbe gilt für die Frage, wann Leiden zu verändern und wann es zu akzeptieren ist. Anders formuliert: Wann handelt der Psychiater als Mediziner und wann als Arzt? Wann handelt er therapeutisch, wann pädagogisch? Noch anders: Wird psychiatrisches Handeln nicht erst jenseits von »Therapie«, in der Konfrontation mit »Unheilbaren« interessant? 15 Totalitär und menschengefährdend kann beides sein: erklären, wo es nichts zu erklären gibt, und verstehen, wo es nichts zu verstehen gibt. 16 Weil das so ist, sind auch die bisherigen Ansätze der Psychiatriegeschichtsschreibung unzureichend, sowohl das ideengeschichtliche Verfahren in der Absicht, »die Tätigkeit des Menschen in der Gesellschaft über die Grenzen des Momentes und des Ortes zu erheben« 17 , als auch das kulturgeschichtliche (Kirchhoff, Birnbaum). Daher hat nach der Zeit des Nationalsozialismus die Nachkriegs-Sozialgeschichte die Kulturgeschichte als abstraktes Korrelat der Machtgeschichte kritisiert. 18 Daher ist auch der Weg der deutschen Wissenssoziologie, wie er von Dilthey gebahnt, von Mannheim beschritten wurde und heute von Gadamer 19 fortgesetzt wird, in Frage gestellt worden. Unsere Bedenken entsprechen der in den letzten Jahren geübten Kritik an der Wissenssoziologie, so von Lenk 20 , Plessner 21 , Wolff 22 , Lieber 23 , Hofmann 24 und Habermas 25 .
Wurde im 18. Jahrhundert die Verhinderung von Erkenntnis der Niedertracht der Herrschenden (Priestertrug-Theorie) bzw. dem subjektiven Vorurteil zugeschrieben, so galt sie im 19. Jahrhundert als objektiv notwendige Ideologie, gemessen an den jeweiligen Schranken des naturwissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Fortschritts. Im 20. Jahrhundert führt das zur Selbstunterwerfung der Erkenntnis und des Urteils unter die Sinnkontinuität des geschichtlich gewordenen Vorurteils, zur selbsttätigen Anpassung an die Gegebenheiten. 26 »Indem die Philosophie ihren Ausgangspunkt, das ›In-der-Welt-Sein‹ des Menschen, selbst wieder auf seine Existenzialien oder bleibenden Bestimmungen hin abfragt, verliert sie Geschichte und Gesellschaft als je konkreten Prozeß entweder ganz aus dem Blick, oder aber sie gerinnen ihr begrifflich zu so etwas wie ›Geschichtlichkeit‹ und Soziabilität‹.« 27 Eine ähnliche Kritik an der Entrückung von Gegenständen in eine phänomenale Begrifflichkeit bzw. in eine je eigene »Welt« trägt Plessner vor: »Die Leiblichkeit als ein Strukturmoment der konkreten Existenz, mit der sie sich auseinandersetzen muß und die sie in den verschiedenen Modi der Zuständlichkeit und Widerständlichkeit durchzieht, wird nicht als Körper zum Problem. Das überläßt man der Biologie und den organischen Naturwissenschaften.« 28
Zum Begriff der Wissenschaft gehört aber beides, nicht nur die fortschreitende Stabilisierung ihrer selbst und durch sie ihrer Gesellschaft (in technischer Beherrschung, Systembildung wie in Sinngebung); zu ihr gehört auch die fortschreitende Aufklärung ihrer selbst und ihrer Gesellschaft. Ein solches objektiv sinnverstehendes Denken bleibt nicht bei dem durch das Bewußtsein der handelnden Individuen vermittelten subjektiven Verständnis stehen. Es »scheidet die Dogmatik der gelebten Situation nicht einfach durch Formalisierung aus, freilich überholt es den subjektiv vermeinten Sinn gleichsam im Gang durch die geltenden Traditionen hindurch und bricht ihn auf«. 29 Solche Soziologie ist nur als auch historische möglich. »Im grundsätzlichen Unterschied zur Wissenssoziologie erhält sie ihre Kategorien aus einer Kritik, die zur Ideologie nur herabsetzen kann, was sie in deren eigener Intention erst einmal ernstgenommen hat.« Objektiv und nicht subjektiv sinnverstehend ist sie, insofern sie es »mit Frakturen von Sinn, in Hegels Sprache: mit dem Mißverhältnis des Existierenden und seines Begriffs zu tun hat«. 30
Die Psychiatrie hat es in ganz besonderer Weise mit »Frakturen von Sinn« im menschlichen Denken und Handeln zu tun. Daher und im historischen Zusammenhang mit der »sozialen Frage« stellt Psychiatrie gewissermaßen eine Soziologie noch vor der Etablierung der Soziologie als Wissenschaft dar. Unsere wissenschaftssoziologische Frage kann also nicht mehr bloß formal lauten, wie bestimmte Extreme menschlichen Denkens und Handelns als besondere gesehen und damit zum Gegenstand einer Wissenschaft werden konnten, sondern sie muß heißen: Wie konnten diese Extreme zu einem bestimmten Zeitpunkt als konkrete gesellschaftliche Not und Gefahr – bedrückend und bedrohlich-faszinierend – sichtbar und wichtig werden? Wie war die Gesellschaft beschaffen, ihre Öffentlichkeit, ihr ökonomisches Entwicklungsstadium, ihre moralischen Normen, ihre religiösen Vorstellungen, der Anspruch ihrer politischen, juristischen und administrativen Autoritäten, damit hier ein (Ordnung und Aufklärung) forderndes Problem hervortreten konnte? Welche gesellschaftlichen Bedürfnisse waren derart zwingend, daß man mit einem Mal bereit war, viel Geld auszugeben, um ein mehr oder weniger umfassendes Versorgungssystem, die Institution Psychiatrie, zu schaffen? Und wie argumentierten das wissenschaftliche und das philosophische Denken zur selben Zeit, um diesem sichtbar gewordenen Bedürfnis und Anspruch zu genügen, um teils aus der Praxis dieser neuen Institution, teils ›freischwebend‹ dem Kanon der wissenschaftlichen Disziplinen ein neues Element einzufügen? Alle weiteren Fragen folgen aus diesen.
3. Methoden der Untersuchung
Nachdem der Gegenstand der Untersuchung bestimmt ist, der Rahmen, in dem er gesehen, und der kritische Anspruch, an dem er durch die Geschichte verfolgt werden soll, bleibt zu klären, woher und wie Material für die Analyse gewonnen werden kann. Gerade weil wir uns mit der Entstehung der Psychiatrie beschäftigen, folgen wir – soweit möglich – Thomas S. Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (1965), worin der Glaube an eine einlinige, kumulative Entwicklung der Wissenschaften einer Kritik unterzogen wird. Für Kuhn entsteht eine Wissenschaft, wenn in der (philosophischen) Diskussion eines Gegenstandsbereichs, verbunden mit einer exemplarischen konkreten Leistung, ein Modell, ein »paradigm«, zur Herrschaft kommt, das 1. für die meisten akuten Probleme offen ist, 2. für eine größere Gruppe (»community«) den weiteren Streit über Fundamentalfragen beendet, aus dem 3. einzelne Theorien, Methoden, Aspekte und Gesetze erst abgeleitet werden, und das 4. wissenschaftliche Institutionen (Berufsstand, Arbeitsort, Zeitschrift, Verein, Lehrbuch, Lehrmöglichkeiten) erst etabliert. Wissenschaftliche Entwicklung vollzieht sich durch Revolutionen, die den politischen durchaus vergleichbar sind, d. h. durch Austausch der Anschauungen (»view of the world«), so daß nicht nur die Theorien, sondern auch die Tatsachen neu betrachtet und konzipiert werden. Die Voraussetzung dafür ist eine Krise, die das alte Paradigma destruierende Einsicht, daß es wesentlichen neuen Problemen und Bedürfnissen gegenüber versagt. Die Folge davon ist eine Diskussion in der Öffentlichkeit zwischen dem alten und dem neuen, alternativen Paradigma-Kandidaten. Das siegreiche Paradigma verspricht, den neuen Bedürfnissen »adäquater« zu sein, wobei politische Autoritäten, individuelle Überzeugungskraft, philosophische Überlegungen, ja ästhetische Adäquanzgefühle durchaus mit eine Rolle spielen können. 31
Читать дальше