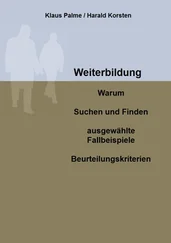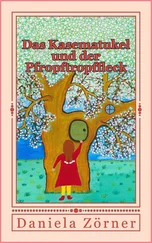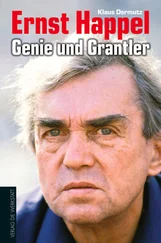1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 17Leibbrand/Wettley, Der Wahnsinn , S. 4.
18Vgl. hierzu fast alle Beiträge in: Wehler (Hrsg.), Moderne deutsche Sozialgeschichte .
19»Offenbar ist es der Sinn der von mir gegebenen Nachweise, daß die wirkungsgeschichtliche Bestimmtheit auch noch das moderne, historische und wissenschaftliche Bewußtsein beherrscht, [...] daß unser im Ganzen unsrer Geschicke gewirktes Sein sein Wissen von sich wesensmäßig überragt.« (Gadamer, Wahrheit und Methode , S. XX). Dagegen Habermas ( Logik der Sozialwissenschaften , S. 175): »Jedoch bleibt das Substantielle des geschichtlich Vorgegebenen davon, daß es in die Reflexion aufgenommen wird, nicht unberührt. [...] Autorität und Erkenntnis konvergieren nicht, [...] Reflexion arbeitet sich an der Faktizität der überlieferten Normen nicht spurlos ab.«
20Lenk, Ideologie , »Problemgeschichtliche Einleitung«, S. 13–57.
21Plessner, »Abwandlungen des Ideologiegedankens«, in: Lenk, a. a. O., S. 218–235.
22Wolff, Einleitung zu: Mannheim, Wissenssoziologie , S. 11–65.
23Lieber, S. 1–105.
24Hofmann, Gesellschaftslehre als Ordnungsmacht .
25Habermas, S. 149–192. Ein Zeichen für die Entfremdung der Psychiatrie von ihrer Geschichte, für ihr unhistorisches Bewußtsein mag es sein, daß zunehmend historische Arbeiten nicht etwa in der psychiatrischen Fachpresse erscheinen, sondern in kostspielig ausgestatteten Serien der pharmazeutischen Konzerne, von deren Vertretern den Psychiatern als wissenschaftlich unverbindlicher, aber werbewirksamer »kultureller Überbau« überreicht.
26»In Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr. [...] Der Fokus der Subjektivität ist ein Zerrspiegel. [...] Darum sind die Vorurteile des einzelnen weit mehr als seine Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines Seins.« (Gadamer, S. 261).
27Lieber, S. 11.
28»Immer noch philosophische Anthropologie?« S. 72.
29Habermas, »Analytische Wissenschaftstheorie«, S. 480.
30Ders., Theorie und Praxis , S. 229.
31Zu den Kriterien der »Träger« einer solchen Revolution gehört es nach Kuhn, daß sie an einem der Krise nahen Problem arbeiten, daß sie noch nicht lange in der betreffenden Wissenschaft tätig, d. h. von deren geltenden Traditionen noch nicht ganz durchdrungen sind, daß sie zuvor schon in einer anderen Wissenschaft mit Erfolg gearbeitet haben, weshalb sie auch über das für ihre Funktion ebenfalls wichtige gesellschaftliche Ansehen verfügen, und daß sie noch relativ jung sind. (Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions , S. 143).
32Kuhn, S. 19 u. 163. Neuerdings hat U. Trenckmann (»Das psychodynamische Konzept...«) Kuhns Paradigma-Konzept an der romantischen Psychiatrie überprüft.
33Hunter/Macalpine, Three Hundred Years of Psychiatry , S. IX.
34Bromberg, »Some Social Aspects«, S. 132.
35Habermas, »Analytische Wissenschaftstheorie«, S. 473 f.
36Ders., Theorie und Praxis , S. 177.
37Ders., Strukturwandel der Öffentlichkeit , S. 7 f.
38Conze, W. sowie H. Mommsen, »Sozialgeschichte«, in: Wehler (Hrsg.), Moderne deutsche Sozialgeschichte , S. 16–26 sowie 27–34.
39Plessner, Die verspätete Nation .
40Foucault, Madness and Civilization . Foucault ist der erste, der mit Entschiedenheit auf die Bedeutung jener Bewegung für die Entstehung der Psychiatrie hingewiesen hat, die wir Ausgrenzung der Unvernunft nennen. Sie erscheint in seinem Buch (S. 38-64) unter dem Titel »The great Confinement«. Allerdings führt sein strukturalistischer Ansatz dazu, daß er über dieser europäischen Bewegung die historischen Differenzen zwischen den einzelnen Ländern aus dem Auge verliert, was häufig Verzerrungen und falsche Verallgemeinerungen zur Folge hat. Im Grunde ist Foucaults Buch von der Situation Frankreichs her geschrieben. Es beweist wie seine Vorgänger, daß es bisher nur wenige Ansätze der Psychiatriegeschichtsschreibung gibt, in denen keine Verzeichnung durch den »nationalen Standpunkt« stattfindet und die in der Lage sind, die Entwicklung der Psychiatrie im Rahmen der Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft zu sehen und daher auch die historischen Differenzen des Entwicklungsstandes der einzelnen Länder wahrzunehmen.
41Hofmann, Ideengeschichte der sozialen Bewegung , S. 22 f.
42Foucault, S. 51: »billige Arbeitskräfte in Zeiten der Vollbeschäftigung und der hohen Löhne, und Unsichtbarmachen der Müßigen sowie sozialer Schutz gegen Agitation und Aufstände in Zeiten der Arbeitslosigkeit«.
43Hier stellt sich die Frage nach einem historisch treffenden, zusammenfassenden Begriff für psychische Störungen. Während die Engländer von »madness«, die Franzosen von »folie« sprechen, kam es in der komplexen und uneinheitlichen Situation Deutschlands nicht zu einem allgemein akzeptierten und bündigen Begriff. Zahlreiche Bezeichnungen konkurrieren miteinander. Wir führen für diese Arbeit die Konvention ein, vom »Irresein« und von den »Irren« zu sprechen, Begriffe, die am wenigsten vorbesetzt sein dürften und in die der ebenfalls in Deutschland fehlende, englisch-französische Bedeutungsgehalt der »Entfremdung« (alienation) eingeht, während etwa »Wahnsinn« schon eine Verengung darstellt.
44Hobbes, Lehre vom Menschen , S. 40; vgl. auch S. 35 f.
45Aus dieser unterstellten Naturnähe stammt der langlebige Glaube, daß Irre Hunger, Kälte und Schmerzen endlos ertragen können. Hier liegt eine praktisch-theoretische Verkehrung vor; denn zunächst setzte man die Irren dem Hunger, der Kälte und den Mißhandlungen aus und schloß von daher sekundär auf ihre Eigenschaften, d. h. auf eine besondere, ihnen eigene Insensibilität; ähnlich sind Typologien etwa »des Arbeiters« entstanden. – Von ganz anderer Qualität ist die zu allen Zeiten von Irrenärzten mitgeteilte Beobachtung des Alternierens von Irresein und bestimmten körperlichen Krankheiten bei einem Individuum. Bis heute gilt diese empirische, in ihrem Wesen noch unerkannte Tatsache als zentrales Beweisstück des körperlichen »Tiefgangs« des Irreseins. Den frühen Irrenärzten bot sich vor allem die finale Konstruktion an, daß das Irresein die Irren vor anderen Krankheiten bewahrt. Auch so konnte man sich der von den »normalen« Menschen abgehobenen Sonderstellung der Irren vergewissern.
II. Großbritannien
1. Ausgrenzung der Unvernunft und Öffentlichkeit
a) Begriffe der politischen Öffentlichkeit
Es war bereits die Rede davon, daß die soziale Bewegung der Ausgrenzung der Unvernunft zwar auch für England gilt, hier sogar besonders früh nachweisbar ist, sich aber nicht in dem Maße durchsetzte, wie es in Frankreich und Deutschland der Fall war. Bereits das erste Drittel des 18. Jahrhunderts zieht jenes soziale Institut der geometrischen Raumverteilung zwischen Vernunft und Unvernunft in eine Diskussion, die seine Auflösung vorbereitet. Es erfolgte in England schon frühzeitig eine Differenzierung, die weniger nach der moralischen und erziehenden Absicht solcher Einrichtungen fragte als vielmehr nach ihrem unmittelbaren Nutzen für die Gesellschaft und für die Internierten selbst, die gerade dadurch in ihrer Unterschiedlichkeit sichtbar werden konnten. So richteten die Manufakturen Proteste gegen die billige Konkurrenz der »workhouses«, und Daniel Defoe kritisierte, daß durch Erziehung der Zöglinge zur Arbeit die Arbeitslosigkeit und Armut nur in andere Gegenden verschoben werde. Freilich war auch in England die Wirtschaft noch keineswegs soweit entwickelt, daß sie die Massen der bettelnden oder vagabundierenden Armen hätte aufnehmen können. Andererseits nahm die Zahl der Unternehmer nicht nur für »workhouses«, sondern auch für die schon damals davon unterschiedenen privaten Irrenhäuser (»lunatic asylums«) ständig zu. Diese nahmen zwar vornehmlich begüterte Irren auf, doch wurden auch Verträge mit den entsprechenden Gemeinden zur Kostenbeteiligung für die Übernahme von » armen Irren« 1geschlossen. Diese »pauper lunatics« sind erstmals 1714 Gegenstand eines Act of Parliament »for the more effectual punishing such rogues, vagabonds, sturdy beggars, and vagrant«; es wird hier nicht nur ihre Internierung, sofern sie gefährlich, »furiously mad« sind, gefordert, sondern die Irren werden hier überhaupt zum ersten Mal getrennt von den übrigen Adressaten solcher Gesetze definiert, und zwar sogleich als »arme Irre«. Ihre Sonderstellung wird dadurch unterstrichen, daß sie als einzige vom Auspeitschen (»whipping«) ausgenommen werden. 2Selbst das Bedlam, die größte Internierungseinrichtung Londons, differenziert seine Insassen und hat, trotz der mit ihm verbundenen Schauergeschichten, viel stärker Krankenhauscharakter als das ihm sonst vergleichbare Hôpital général von Paris. Doch gab es freilich im Bedlam noch Schaustellungen der Irren, als dies im Frankreich nach der Revolution schon undenkbar geworden war. Gerade insofern war das Bedlam seit seinem monumentalen Neubau (1676) ständiger Gegenstand der öffentlichen Diskussion und wurde immer wieder zum kritischen Ansatzpunkt sozialer Reformversuche.
Читать дальше