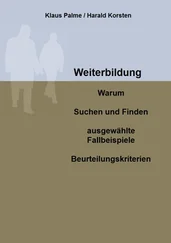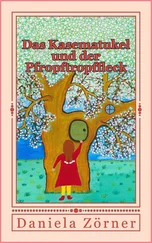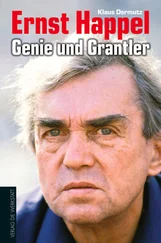Daß das Irresein in dieser Zeit als ein im weitesten Sinne politisches Thema gesehen werden muß, zeigt sich darin, daß auch seine medizinische Sicht engstens mit den Begriffen der sich entfaltenden bürgerlichen Öffentlichkeit verflochten ist. »Madness« und »english malady« waren bevorzugte Themen in den Kaffeehäusern. Locke und Mandeville waren selbst Ärzte und beschäftigten sich mit den Irren ebenso wie die Naturwissenschaftler Boyle und Hooke und die politischen Literaten Defoe und Swift. Neben dem Interesse für die inhaltliche Problematik ist eine Voraussetzung hierfür die Nähe zwischen den politischen und den naturwissenschaftlich-medizinischen Vorstellungen und ihre nachgerade materiell-körperliche Bezogenheit aufeinander, die der Analogie noch nicht bedarf. Namentlich Begriffe aus den Gründungsjähren der Royal Society of London wirken in jener Zeit noch in einer zugleich körperlichen und sozial-moralischen Substantialität, die im folgenden Jahrhundert in ihren verschiedenen subjektiven, objektiv-neutralisierenden und metaphysischen Ausformungen zur größten Verwirrung führen, ehe sie sich in der Arbeitsteilung des modernen Wissenschaftsbetriebs scheinbar beruhigen werden. So hängt die Möglichkeit, den doch unsichtbaren »public spirit« als eine politisch reale – empfindende und bewegende – Kraft zu konzipieren, durchaus mit der medizinischen Spirit-Lehre zusammen, und zwar besonders so, wie sie Thomas Willis (1667) zur ersten zusammenhängenden Neurologie auf anatomischer Grundlage ausformulierte. Für ihn werden die »spiritus animales« innerhalb der Organe vom äußeren Gegenstand erschüttert, nach innen getrieben und schaffen so die Empfindung. Schaltstelle dieser in den Nerven wellenartig vor- und rückwärtsgehenden und zugleich mechanisch angestoßenen Bewegungen ist – und hier liegt das Fundament des anderen Zentralbegriffs der bürgerlichen Öffentlichkeit – der »sensus communis«, der Gemeinsinn in der Hirnmitte. Dieser bewirkt nicht nur die Wahrnehmung des empfundenen Dinges; er vermittelt auch den Weg zu Einbildung, Phantasie und Gedächtnis. Weiter werden die »Nervenspirits« reflexiv vom Gemeinsinn von innen wieder nach außen getrieben. Er erweckt also Begehren bzw. eine entsprechende motorische Bewegung sowie bei häufiger Wiederholung ein sich automatisch vollziehendes Kausalverhältnis von Empfindung und Bewegung, d. h. Gewohnheiten.
Willis ist aber nicht nur »the first inventor of the nervous system«, er gibt auch die neurologisch beschriebene Tätigkeit der Nervenspirits wieder als begeistet von der »Corporeal (vital and sensitive) Soul«, ebenfalls als feine und aktive Materie der Hirnmitte und überdeckt von der rationalen Seele vorgestellt; in dieser Hinsicht bringt er die Nervenvorgänge unter den von ihm in die Medizin eingeführten Titel der »Psycheology«.
Dieses neurologisch-psychologische System Willis’ verdrängte die humoral-chemischen Erklärungen der Tradition und prägte das 18. Jahrhundert. Krankheiten ergeben sich aus mechanischen Erschütterungen durch äußere Objekte. Die Formen des Irreseins entstehen, wenn keine materielle Schädigung sichtbar ist, da hier lediglich die nur an ihren Wirkungen erkennbaren Nervenspirits lädiert sind. Damit ist jener Bereich geschaffen, der auch nach Ende der in substantiellen Leib-Seele-Beziehungen denkenden Ära nahezu beliebige psychische, moralische, soziale und politische Phänomene »krank« oder »abnorm« zu nennen erlaubte – gerade wegen der Unsichtbarkeit der gleichwohl postulierten (oder bestrittenen) materiellen Läsion. Das Moment der Macht des Unsichtbaren, das der Lehre von den »spirits« und vom »common sense« eigen ist, gestattete Differenzierung durch Räsonnement für den Arzt wie für den Politiker: ob etwas Strittiges gesund oder krank, günstig oder gefährlich, der bürgerlichen Gesellschaft zugehörig oder von ihr ausgegrenzt sein soll.
b) Hysterie und Identität des Bürgers
Es fällt auf, daß Willis nur die Hysterie und die ihr ähnlichen Störungen fast ganz in seine Nerventheorie einbringt, sie von ihrem altehrwürdigen Sitz im Uterus löst und zu einem »nervösen« Leiden macht. Die Melancholie hingegen wird teils noch traditionell-chemisch, teils in den Nervenspirits (das leere Reden) und teils im Herzen (die traurigen Gefühle) lokalisiert. Dabei knüpft die theoretische Erklärung (»low spirits«) mehr ans Nerven-Modell, die Therapie (traurige »passions« durch angenehme ersetzen) mehr an das Herz an – erste Andeutung späterer Arbeitsteilung zwischen theoretisch-naturwissenschaftlichem und praktisch-romantischem Ansatz. Noch peripherer und nur als Ableitung von anderen Bildern erscheinen bei Willis Manie bzw. »madness«, also die zentralen Formen des Irreseins.
Es ist dies ein genaues Abbild davon, daß die Hysterie in der Öffentlichkeit bzw. in der öffentlichen Diskussion zugelassen ist und hier auch eine bedeutende Rolle spielt, während die Irren weitgehend noch unter dem Verdikt der tatsächlichen und dadurch auch der wissenschaftlichen Ausgrenzung der Unvernunft stehen, weshalb bis zur Jahrhundertmitte auch nicht von einer theoretisch-praktischen psychiatrischen Wissenschaft gesprochen werden kann. Diese Situation kann durch nichts besser beschrieben werden als durch die rationalistisch-dressierende, strafende und grausame Behandlung, die Willis den eigentlich Irren für angemessen hält: »For the curing of Mad people, there is nothing more effectual or necessary than their reverence or standing in awe of such as they think their Tormentors. [...] Furious Mad-men are sooner, and more certainly cured by punishments, and hard usage, in a strait room, than by Physick or Medicines. [...] Let the diet be slender and not delicate, their cloathing course, their beds hard, and their handling severe and rigid.« 15
Th. Sydenham, ebenfalls aus der Royal Society und befreundet mit Lokke und Boyle, bringt 1682 mit seiner Beschreibung der Hysterie eine weiterführende Vermittlung von Willis und Glisson 16zustande, die zugleich unter der Hand zu einer Art moralischer Beschreibung der bürgerlichen Öffentlichkeit Englands der Wende zum 18. Jahrhundert gerät. Er identifiziert weitgehend – was das klinische Bild angeht – die bei Frauen vorherrschende Hysterie mit der Hypochondrie, ihrem Äquivalent bei Männern, und mit der Melancholie. Er vervollständigt also hier die bei Willis bemerkte Tendenz. Vom eigentlichen Irresein ist bei ihm um so weniger die Rede. Frei von Hysterie sind fast nur Frauen »such as work and fare hardly«. Umgekehrt sind von den Männern vor allem von dieser Störung befallen solche, »who lead a sedentary life and study hard« 17, also Männer mit einer Tätigkeit in kaufmännischen oder sonstigen Büros und in akademischen oder literarischen Berufen. Damit ist mit dem Begriff der Hysterie ziemlich genau der Bereich der ökonomischen und der literarisch-humanen, d. h. für einen Akademiker sichtbaren bürgerlichen Öffentlichkeit gemeint. Der typische Bürger leidet auch an Hysterie bzw. Hypochondrie. Das übrige bleibt mehr oder weniger im Dunkel – eine gesellschaftliche Sichtverkürzung, die (nicht nur) Psychiater immer wieder zu Fehlschlüssen führen wird.
Erklärt wird die Hysterie zunächst durch Unordnung, Ataxie der Spiritus animales. Es bedeutet aber eine Verinnerlichung des Prinzips Willis’ – jetzt auch methodisch –, wenn Sydenham dann differenziert: »As the body is composed of parts which are manifest to the senses, so doubtless the mind consists in a regular frame or make up of the spirits, which is only the object of reason. And this being so intimately united with the temperament of the body, is more or less disordered, according as the constituent parts thereof, given us by nature, are more or less firm.« 18Man darf wohl der Interpretation Foucaults folgen, daß hier die neutralisierende naturwissenschaftliche Beobachtung Willis’ durch eine innere Sicht ersetzt ist, die durch Beziehung der Spirits auf die Dichte der Konstitution die innerlichkörperliche Dimension mit der moralischen zusammenbringt, die Schwäche der Konstitution mit der Schwäche des Herzens. 19Denn Sydenham begründet gerade aus diesem Zusammenhang die größere Disposition der schwächeren Frauen für die Hysterie und damit kulturkritisch den inkonstanten, weiblichen Charakter der neuen bürgerlichen Gesellschaft: »Hence women are more frequently affected with this disease than men, because they have receiv’d from nature a finer and more delicate constitution of body, being designed for an easier life and the pleasure of men, who were made robust, that they might be able to cultivate the earth, hunt and kill wild beasts for food, and undergo the like violent exercises.« 20
Читать дальше