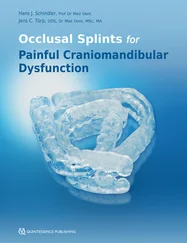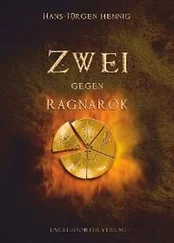Es ist damit nicht unterstellt, Blumenberg habe die Erforschung von Rezeptionsverhältnissen gering geschätzt. In seiner Studie »Selbsterhaltung und Beharrung« 200etwa untersucht er penibel, ob sich stoische Anleihen im modernen Konzept der ›Selbsterhaltung‹ finden, welche Rolle Cicero dabei zukommt und inwiefern sich bei Newton und Spinoza ein Neuansatz des Konzeptes der conservatio sui , der Selbsterhaltung, aufweisen lässt; oder man lese den Aufsatz über »Kritik und Rezeption antiker Philosophie in der Patristik«, 201um sich von der quellengesättigten Arbeit an der Rezeptionsgeschichte ein Bild zu machen, zu der Blumenberg fähig und willens war. Aber Blumenberg ist nicht bereit, sich durch Aufweisforderungen einer Rezeptionsgeschichte im philosophischen Ausdeuten des Quellenmaterials einengen zu lassen. Bei aller philologischen Genauigkeit, zu der er fähig war, hat er bis in die Gestalt seiner Bücher hinein von einer Philologisierung der Philosophie und ihrer Geschichte Abstand gehalten. Er hat das zu markieren gewusst, indem er keinesfalls jedes Zitat mit einem Quellennachweis versehen hat. Als penibler Arbeiter erlaubte er sich hier eine Freiheit gegenüber dem wissenschaftlichen Standard und wählte einen Ausdruck dafür, dessen strenge Methodik nicht teilen zu wollen. Einer, der so viel und aus entlegensten Quellen, oft in der Originalsprache, zitiert hat, wollte nicht als Philologe missverstanden werden. Damit ist keine Geringschätzung der Philologie verbunden – sein Mitarbeiter Karl-Heinz Gerschmann war Philologe –, wohl aber eine Selbstbehauptung der Philosophie als Philosophie.
Wie stringent Blumenberg seinen philosophischen Selbstanspruch zum Formprinzip seiner Texte hat werden lassen, lässt sich an einem weiteren Detail ablesen. Der »Anspruch der Erklärung macht die Historie notwendig zur Wissenschaft in der Dimension des Perfekts«, 202heißt es in der Habilitationsschrift. Um der vergegenständlichenden Ruhigstellung von geschichtlichen Phänomenen zu entgehen und das Geschichtliche als Phänomen hervortreten zu lassen, nutzt Blumenberg in seinen Darstellungen geistesgeschichtlicher Zusammenhänge sehr oft das Präsens.
Der historischen ›Tatsache‹ als Baustein von Erklärungszusammenhängen stellt Blumenberg schließlich und als Konsequenz seiner Art von Methode das ›Phänomen‹ gegenüber. Der gegenständlichen Auffassung von Geschichte widerspricht ihre »phänomenale Gegebenheit«. 203Was ist dabei mit dem Stichwort des Phänomens und des Phänomenalen gemeint? Es ist sinnvoll, hier Vorsicht walten zu lassen und nicht mehr Eindeutigkeit zu suggerieren als die Auskünfte Blumenbergs hergeben. Wirft man einen Blick in Blumenbergs Schriften, stößt man auf verschiedene Verwendungssituationen des Ausdrucks ›Phänomen‹: Da ist von der »Phänomenbasis« 204die Rede, es wird eine »Phänomenologie der Rezeption des Mythos« 205in Aussicht gestellt, ebenso eine »Phänomenologie der Bedeutsamkeit« 206und eine »Phänomenologie der Figur«. 207Zwar bietet Blumenberg gelegentlich »ein Stück historischer Phänomenologie« 208und nimmt in seinem letzten zu Lebzeiten publizierten Buch, Höhlenausgänge , die Aufgabe einer »Phänomenologie der Geschichte« ins Visier, fügt aber an: »sobald es sie geben sollte«. 209Es gibt sie also noch nicht, heißt das. Wozu dann die Rede vom Phänomen des Geschichtlichen, gar von einer Phänomenologie der Geschichte?
Die Philosophie, führt Blumenberg einmal aus, habe kein anderes Verfahren, »ihre ›Phänomene‹ zu konservieren, als sie zu beschreiben. Sogar wenn sie ihre eigene Geschichte schreibt, beschreibt sie das Hervortreten ihrer ›Phänomene‹, für die es keine andere Präparation gibt als eben diese Geschichte. Und wie das geschieht, ist wiederum eines ihrer ›Phänomene‹.« 210Während die ontologische Distanz auf die Eindeutigkeit des Zugriffs auf zum Gegenstand Gemachtes setzt, lässt eine phänomenologisch beschreibende Philosophie etwas hervortreten, was von der Beschreibungsweise nicht unabhängig gedacht werden kann. Diese Art von Phänomen erscheint und erhellt sich nur in der Beschreibung. Der mitunter vage Gebrauch der Begriffe ›Phänomen‹ und ›Phänomenologie‹ – letzteres nicht im strikten Sinne Husserls – mag seinen Grund darin finden, ein Phänomen nicht zwanghaft zum klar und deutlich abgegrenzten Gegenstand der Erkenntnis machen zu wollen. Damit verbindet sich die aus Einsicht gespeiste Vorsicht, »daß die Phänomene nicht nur Sachen unserer Demonstrationen sind« und der Theorie eine »beliebige und jederzeitige Zugänglichkeit der Gegenstände« 211nicht möglich ist.
Es gibt eine Vagheit des zu Erfassenden, eine Unschärfe des zu Bestimmenden, die ihren Grund in der Sache und nicht in einem Mangel der Methode hat. Es gibt ein »Dämmerlicht …, wo jeder Umriß, jede Andeutung dem Verstehen hilfreich werden kann«. 212Vorsicht gebiete die Erfahrung mit den »dialogtheoretischen Einführungszwängen für Begriffe«, denn immer wieder erweise sich »als eine der Illusionen im Umgang mit Theorien aller Art, daß von dem Bestimmungsgrad der Begriffe, die sie einführen und verwenden, ihre Qualität schlechthin abhinge«, dabei zeige sich doch oft, »daß die Strenge bei der Bildung oder Zulassung von Begriffen eher Sterilität begünstigt als präzisen Fortgang bewirkt«. 213Auch was ›Phänomen‹ sein soll, bedarf daher der behutsamen Beschreibung und sperrt sich gegen die vorschnelle begriffliche Definition. Immerhin gilt: »Was nicht zu ›erklären‹ ist, bleibe lieber im Ungeklärten als im Genügen einer prätendierten Verstandenheit.« 214
Ein Mythos hilft hier weiter. In einer der anrührendsten Erzählungen unserer Tradition wird die tragische Geschichte eines Liebespaares erzählt, das sich gleich zweimal verliert. Zuerst trennt der Tod Orpheus und Eurydike, nachdem Eurydike von einer Schlange gebissen wurde. Doch durch die Kunst seines betörenden Gesangs kann Orpheus, der von seiner Geliebten nicht lassen will, die Herrscher der Unterwelt der Toten dazu bewegen, ihm Eurydike zu überlassen. Von seinem Gesang ergriffen, erfüllen sie seinen Wunsch, allerdings unter der Bedingung, er dürfe sich auf dem Weg aus der Unterwelt als Vorangehender nicht nach Eurydike umschauen. Beide haben schon fast die Oberwelt erreicht, als Orpheus nicht mehr an sich halten kann und sich nach seiner Geliebten umwendet, um sich ihrer Gegenwart zu vergewissern. Diesen Tabubruch bezahlt Orpheus mit dem erneuten und endgültigen Verlust Eurydikes. Sie sinkt ohne Wiederkehr zurück in das Dunkel der Unterwelt.
Dieser Mythos lässt sich auch philosophisch lesen, als Erzählung davon, was geschieht, wenn man mitunter Gewissheit zu erzwingen sucht. Dann stellt der Orpheus’sche Blick zurück den Sündenfall eines Denkens dar, das nach Gewissheit verlangt, wo sie nicht zu haben ist. Im Moment der Umkehr wird Orpheus zum Cartesianer, der Klarheit und Eindeutigkeit zu erzwingen sucht, wo allein die Kunst der Beschreibung phänomenerschließend gewesen wäre. Ernst Cassirer, ein äußerst behutsamer Führer aus der Unterwelt des Vorwissenschaftlichen, wusste genau um diese Gefahr des Entgleitens des theoretisch Bedachten. Bei der Bestimmung der Funktion eines vormythischen, eines vorlogischen und eines vorästhetischen Wahrheitsfundaments weist er auf diese Erschließungsproblematik hin, denn es scheint uns »diese Wahrheit um so mehr zu entgleiten, je mehr man sie zu fixieren versucht: d. h., je mehr man sie von vornherein auf ein einzelnes Gebiet ›festlegt‹ und sie ausschließlich mittels der Kategorien desselben bezeichnen und bestimmen will«. 215So leicht es sei, ergänzt Blumenberg, »den ausschließlichen Gebrauch klarer und distinkter Begriffe zu fordern und alles vom Tisch zu wischen, was der Strenge vorgängiger Begriffsklärung nicht genügt, so problematisch ist es, jene vielleicht noch flüchtige und wenig konturierte Gegenständlichkeit zu gefährden, die als Konvergenzpunkt bis dahin verstellter Aspekte aufzuspüren gerade der interdisziplinären Anstrengung obliegen sollte«. 216Und so leicht es ist, methodisches Vorgehen einzufordern, so wenig ist damit gewonnen: »Feststellungen zur Methode erklären ohnehin zumeist nicht viel«, 217heißt es lapidar und abschließend.
Читать дальше