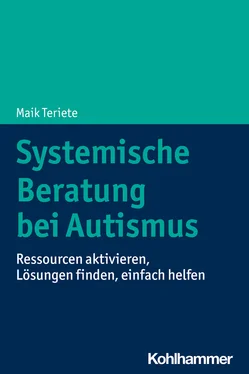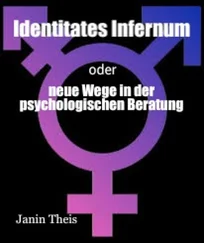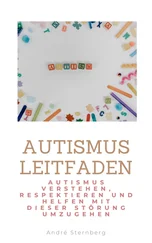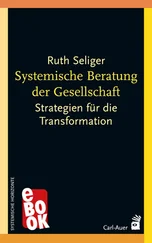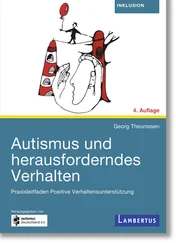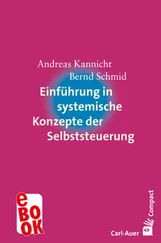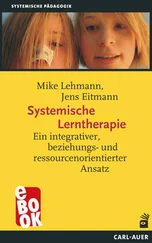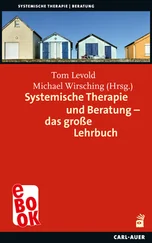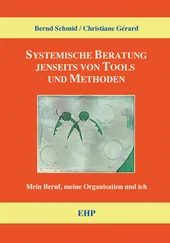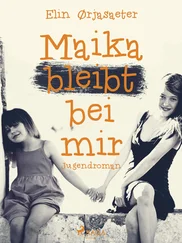Manche Eltern autistischer Kinder leiden ferner unter dem Umgang mit dem Thema Autismus. Wiederholte Erklärungen, warum sich ihre Kinder anders verhalten und auch, warum sie anders mit ihnen umgehen, werden als mühsam oder anstrengend empfunden.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Aspekte ist es nicht verwunderlich, dass erlebter Stress im Umgang mit den eigenen Kindern ein häufig angesprochener Grund für Belastungen in der Beratung von Eltern autistischer Kinder ist – ein wiederkehrendes Thema, sowohl bei den Angehörigen und Bezugspersonen als auch bei den Betroffenen selbst.
Positive Erfahrungen mit Autismus in der Familie
Der Idee der »Resilienz« folgend, gibt es natürlich auch Eltern, die mit den Herausforderungen gut umgehen können und womöglich gestärkt hervorgehen aus den schwierigen Erfahrungen im Alltag. Diese Eltern sind in der Lage, eine positive Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Sie beschreiben Erfahrungen, die sie ohne den Autismus nie gemacht hätten und für die sie sehr dankbar sind.
Humorvolle Momente im Familienalltag, die ohne Autismus so nicht erlebt worden wären, zu erkennen und wertzuschätzen, kann ebenfalls stärkend wirken. Es kann beispielsweise befreiend wirken, wenn die eigenen Kinder gesellschaftliche Konventionen ignorieren und nur ihren Bedürfnissen nachgehen. Sie machen Dinge, die sich andere nie trauen würden und besitzen oftmals die Fähigkeit, sehr nüchtern und schnell Fakten schaffen, wo andere lange abwägen würden und unter Umständen nie zu einer Entscheidung kämen.
Ein Junge mit Autismus hat die Angewohnheit, beim Einsteigen in Straßenbahnen laut »Platz da!« zu rufen und sich so möglichst ungestört durch herumstehende Fahrtgäste in den hinteren Straßenbahnteil zu begeben. Wenn dort ein Platz besetzt ist, auf dem er gerne sitzen würde, fordert er diese Mitfahrenden gestikulierend auf, den Platz zu verlassen, damit er sich dorthin setzen kann. Die anderen Fahrtgäste sind zumeist so überrascht durch dieses Verhalten, dass sich der Junge in der Regel ohne Probleme durch den Bus bewegen und auf seinem bevorzugten Sitz Platz nehmen kann.
Fragen zum Thema »richtige« Erziehung
Das Thema »richtige« Erziehung kann durch die beschriebenen Erfahrungen und damit einhergehenden Selbstzweifel innerhalb von Familien mit Kindern mit Autismus zu intensiven Diskussionen führen. In der Beratung begegnet man Haltungen wie »Man kann nicht alles abnehmen, diese Kinder müssen erleben, was es heißt, ein Problem zu haben und daraus Konsequenzen ziehen können«. Wohingegen andere Eltern dazu tendieren, den Kindern alles abzunehmen, das ganze Familienleben auf das autistische Kind abzustimmen und dessen Regeln auf das gesamte System zu übertragen. Beide Strategien erweisen sich im Alltag einerseits zielführend und andererseits problematisch.
Bei autistischen Kindern scheitern viele herkömmliche pädagogische Konzepte. Um sich konstruktiv und lösungsorientiert mit ihren Kindern zu erleben, benötigen Eltern spezielles Wissen und besondere Fähigkeiten.
Wissen um das Thema Autismus
Das Wissen über das Thema Autismus ist bei den betreffenden Eltern zum Zeitpunkt der Diagnose meist eher gering, wie die Erfahrung aus der Beratung zeigt. Gerade das Internet hält eine große Fülle an unterschiedlichen Informationen bereit, was oft zur Folge hat, dass die eigenständige Recherche zu mehr Verwirrung als Klarheit führen kann. Zudem erhalten die Eltern durch diese Informationen oftmals noch keine konkreten Ideen oder Hilfestellungen, die eine entlastende und nachhaltige Wirkung auf den Alltag zuhause haben kann.
Hilfen für Familien mit autistischen Kindern
Hilfen durch Praxen und Kliniken über die Diagnosestellung hinaus werden erfahrungsgemäß nur sehr begrenzt angeboten. Einige dieser speziellen Einrichtungen bieten den Familien regelmäßige Termine an, bei denen über die aktuelle Situation und weitere mögliche weitere begleitende Maßnahmen wie beispielsweise Logo- und/oder Ergotherapie gesprochen werden kann.
Entsprechend der Tradition der ersten Hilfen für diese Familien in Deutschland aus den 1970er Jahren, organisieren sich Eltern autistischer Kinder häufig auch selbst und schaffen auf diese Weise entsprechende Angebote. Manchmal entsteht diese Initiative dabei aus der Not heraus, nicht oder nur unzureichend strukturell und spezifisch unterstützt zu werden. Die mögliche Wirkung auf das eigene Leben vieler Eltern ist nicht zu unterschätzen. Das Weitergeben von Wissen hinsichtlich der Bearbeitung von formellen Anträgen bzw. der Austausch über die verschiedenen Möglichkeiten der weiteren Unterstützung für die eigene Familie kann sehr hilfreich sein.
Zeitnahe und umfassende Hilfe in Form von autismusspezifischen Fördermaßnahmen, die beispielsweise auch Elternseminare und Angebote für weitere Familienangehörige beinhalten, sind in der Praxis meist schwierig zu erreichen. Sie erfolgen meist erst nach vollständiger Klärung der Kostenübernahme und teilweise monate- bis jahrelanger Wartezeit. Eine Anlaufstelle für derartige Unterstützungen finden diese Eltern bei unterschiedlichen Trägern.
Situation von Familien mit Kindern mit Behinderung
Mit vielen der Herausforderungen, denen sich Familien von Kindern mit Autismus stellen müssen, sind auch Familien mit Kindern, die durch andere psychische bzw. körperliche Beeinträchtigungen oder Behinderungen einen »von der Norm abweichenden« Lebensweg beschreiten, konfrontiert. Im Folgenden soll daher der Blick über den reinen »Autismus-Tellerrand« geworfen und stattdessen das generelle »Leben mit einem Kind mit Behinderung« in den Fokus gerückt werden.
Dabei ist die Verwendung des Begriffs »Behinderung« nicht unproblematisch. »Behinderung« ist meist mit einem gewissen »Stigma« verbunden und suggeriert »Unveränderbarkeit« (Retzlaff, 2016, 10). Dass Menschen durch Diagnosen mitunter »behindert gemacht« werden, wird auch im Bereich Autismus bereits seit längerer Zeit problematisiert. Menschen mit Autismus weisen immer wieder selbst auf die potenziell stigmatisierenden Auswirkungen einer Diagnosestellung hin. Gee Vero beispielsweise, bei der erst mit 37 Jahren Autismus diagnostiziert wurde, äußerte sich in ihren Vorträgen kritisch dazu, automatisch als »gestört« betrachtet zu werden, wenn man die Diagnose »Autismus-Spektrum-Störung« erhalte. Autismus bedeutet für einige dieser Menschen, besondere, vielleicht sogar herausragende Fähigkeiten und Eigenschaften zu haben, die »Neurotypische« 2 2 Begriff, den Menschen mit Autismus nutzen, um Menschen ohne Autismus zu beschreiben.
nie erwerben werden.
Vor dem Hintergrund der zahlreichen Besonderheiten, die aber eben auch mit Einschränkungen und Belastungen einhergehen können, ist eine »störungsspezifische« Perspektive allerdings oftmals sinnvoll bzw. notwendig.
Dabei soll es bei den folgenden Beschreibungen auf keinen Fall darum gehen, Familien mit Kindern mit Behinderung zu »stigmatisieren«. Ziel ist vielmehr, das Besondere an ihrer Situation in den Fokus zu rücken, die Aspekte mit all ihren Chancen und Risiken wahrzunehmen und so für die Beratung nutzbar zu machen.
Retzlaff (2016) beschreibt, wie sich Belastungen, die mit Behinderungen einhergehen, auf die Struktur von Familien auswirken können. Die Sorge um das beeinträchtigte Kind und dessen hat auch Auswirkungen auf alle anderen Familienmitglieder. Diese Notwendigkeit eines Mehr an Aufmerksamkeit findet sich auch, wie schon beschrieben, im Bereich Autismus.
»Im Umgang mit der Krankheit wandeln sich Rollenverteilung und Routinen, oft im Sinne einer Akzentuierung vorhandener Rollenmuster. Zwischen den Familienmitgliedern müssen Aufgaben und Verantwortlichkeiten neu verteilt werden. Vertraute Aktivitäten werden leicht aufgegeben. Familien mit behinderten Kindern zeigen eine Tendenz zu einer innerfamiliären Orientierung (Retzlaff, 2016, S. 53).«
Читать дальше