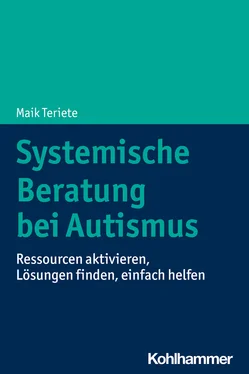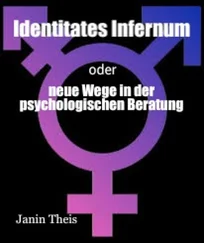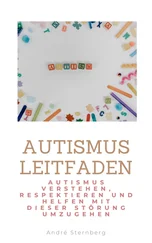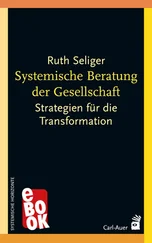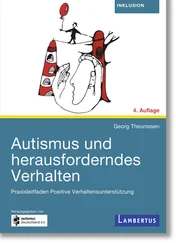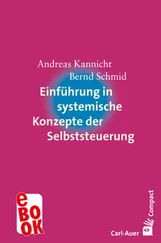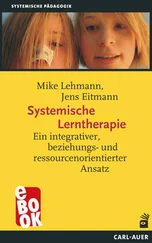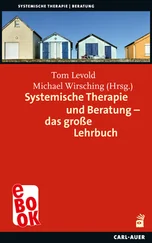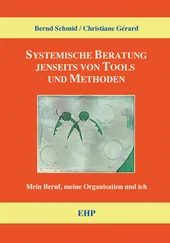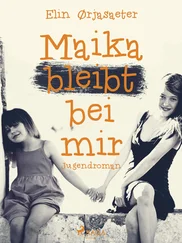Auch Vogeley betont die Wichtigkeit dieses Punktes. In einer Bedarfserhebung bezüglich der Ziele einer autismusspezifischen Hilfe wurde von den Betroffenen oft das Thema »Umgang mit Stress« benannt. »Interessanterweise gaben die Befragten als das am häufigsten genannte Ziel an, dass sie sich Hilfen im Umgang mit Stress wünschen (67 %)« (Vogeley, 2016, S. 181).
Hilfe im Bereich »Stress« bieten Strategien, die durch Reizreduktion oder Hemmung der Reizintensität zu Entlastung führen bzw. eindeutige sensorische Rückmeldungen ermöglichen. Die bekannte amerikanische Autorin und Viehzucht-Expertin Temple Grandin, bei der das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, baute sich beispielsweise zu einem solchen Zweck eine Art »Ganzkörper-Presse« aus gepolsterten körperlangen Platten. Mit Hilfe dieser Apparatur verschafft sie sich durch pneumatisch erzeugten Druck auf ihren Körper Momente der Entspannung.
Leicht umsetzbare und oft nützliche Hilfestellungen für Menschen im Autismus-Spektrum zur Unterstützung körperlicher Entspannung:
• Massagen (Finger, Hände, Ganzkörper)
• elektrische Massagestäbe, die selber bedient werden
• Schlafen in einem Schlafsack
• Ruhemomente (oder auch Schlafen) in einer Hängematte
• schwere Decken zum Schlafen
• aufblasbare oder mit Sand gefüllte Westen
• mit Quarzsand gefüllte Manschetten am Handgelenk für eindeutige körperliche Impulse
• Schulmaterialien wie Stifte mit Sandpapier umhüllen, ebenfalls um eine klarere sensorische Rückmeldung zu erhalten
In den letzten Jahren wurden zum Thema Entspannung erfreulicherweise einige konkrete Hilfsangebote für Menschen mit Autismus entwickelt. Annelies Spek (Hogrefe, 2012) beschreibt z. B. in ihrem Buch »Achtsamkeit für Menschen mit Autismus« ein Training, das speziell für diese Gruppe von Menschen entwickelt wurde.
2.2 Was bewirkt Autismus bei Familien?
Die Tante einer erwachsenen Frau mit Autismus bringt ihrer Nichte, die nur ein paar Häuser weiter lebt, spontan etwas von der übriggebliebenen Weihnachtsgans, um ihr eine Freude zu bereiten. Die Nichte weist ihre Tante gleich an der Wohnungstür ab und beschimpft diese. Sie wirft ihr vor, dass dies eine sehr schlechte Idee sei und sie die Gans nicht haben wolle. Die Tante ist über diese Situation sehr betrübt und fühlt sich verletzt.
Ähnlich wie bei den betroffenen Menschen mit Autismus selbst, sind auch die Auswirkungen von Autismus auf das Familienleben vielfältig.
Es lohnt sich in diesem Zusammenhang den Begriff der »Resilienz« genauer zu betrachten. Der Begriff Resilienz bezieht sich ursprünglich eigentlich »explizit nicht auf Therapeuten oder therapeutisches Vorgehen, sondern auf Menschen in ihrem natürlichen Umfeld, die aus widrigen Lebensumständen etwas Gutes machen – in den meisten Fällen übrigens ohne Therapie« (Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2006, S. 10). Grundsätzlich geht es um die Frage, wie Entwicklung und Wachstum trotz erschwerter Bedingungen oder widriger Umstände möglich ist bzw. wie oder was man daraus eventuell sogar lernen kann (Welter-Enderlin & Hildebrand, 2006).
Retzlaff beschreibt »Resilienz« folgendermaßen: »Aus systemischer Perspektive kann Resilienz als das Potenzial von Familien als Organisationseinheit verstanden werden, Belastungen abzupuffern, sowie als Ergebnis gelungener Adaptionsprozesse an eine widrige Lebenssituation« (2016, S. 111).
Zum Thema Familienresilienz schreibt er:
»Das Familien-Resilienzmodell greift Konzepte und Ergebnisse der individuellen Resilienzforschung, der Familien-Stresstheorie und des Familien-Kompetenzen-Modells auf (Beavers & Hampson 1993, Patterson 2002 a, Walsh 1998). […] Zu den Schlüsselprozessen der Resilienz zählen Familienprozesse, die familiäre Kommunikation, die Aufgaben- und Rollenverteilung, der Umgang mit Grenzen und Konflikten und die Aktivierung von sozialer Unterstützung.« (Retzlaff, 2016, 93; Hervorh. i. O.)
Es gibt also eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die eine Rolle dabei spielen können, wie Belastungen in Familien mit Kindern mit Behinderungen erlebt und »durchlebt« werden. Mögliche spezifische Belastungen sollen im Folgenden beschrieben werden.
Für einige Eltern kann die Diagnose »Autismus« durchaus eine Erleichterung darstellen, nämlich dann, wenn sie hierdurch endlich eine Erklärung dafür erhalten, warum beispielsweise ein wechselseitiger Kontakt mit ihrem Kind so schwer herstellbar ist. Auch eine Erklärung für das »Scheitern« ihrer erzieherischen Impulse kann helfen, sich keine Vorwürfe mehr zu machen.
Andere Eltern erleben die Diagnose als schweren Schlag. Sie machen sich viele Gedanken über die negativen Auswirkungen dieser Diagnose auf das Leben ihrer Kinder und ihr eigenes.
Die Diagnose wird bei den Betroffenen – gemessen an ihrem Alter – unterschiedlich früh oder spät gestellt. Es kann also sein, dass eine Familie die Diagnose erhält, wenn ihr Kind zwei Jahre alt ist, oder aber, wenn das »Kind« bereits über fünfzig Jahre alt ist. Entsprechend unterschiedlich sind folglich die jeweiligen Lebenssituationen der Familien, in denen sie das Thema »Autismus« erreicht.
Zur Frage, inwieweit Familien vorbereitet sein können auf die Diagnose »Behinderung« bei ihrem Kind schreibt Retzlaff: »Eltern erreichen das ›Land von Behinderung und Krankheit‹ ohne eine psychosoziale Landkarte dieser unvertrauten Region zur Verfügung zu haben.« (2016, 182).
Ist Autismus nicht schon in der Familie bekannt, weil beispielsweise ein Angehöriger autistisch ist, trifft Familien die Diagnose oft komplett unvorbereitet. Brita Schirmer beschreibt dies mit dem Begriff der »Traditionslosen Eltern«, den sie von Hackenberg übernommen hat (2015, 29). Eltern von Kindern mit Autismus haben noch nirgends »lernen« können, wie sie ihre Kinder gut erziehen können. Entsprechende Vorbilder in der eigenen Erziehung oder der Austausch mit Freundinnen bei besonderen Fragen stehen in diesen Fällen meist nicht zur Verfügung.
Die besondere Situation von Familien mit einem autistischen Kind
Familien mit einem autistischen Kinde erleben sehr spezifische Schwierigkeiten, die mit der Entwicklung ihres Kindes zusammenhängen ( 
Kap. 3.1
). Diese Besonderheiten wirken sich auf das gesamte Familiensystem aus.
An vielen Stellen sind diese Eltern besonders stark gefordert und benötigen spezielle Fähigkeiten, um mit den Herausforderungen umgehen zu können. In gewöhnlichen Situationen müssen sie u. U. »mehr« leisten, z. B. weil sie ihren Kindern immer wieder durch die gleichen Hinweise daran erinnern müssen, sich fertig anzuziehen, die Zähne zu putzen etc. ohne, dass hier nach einigen Malen eine Lernkurve erkennbar wäre. Entsprechend häufig taucht das Thema »Selbstständigkeitsentwicklung« in der Beratung dieser Familien auf.
Wertschätzung für ihre Anstrengungen erleben Eltern autistischer Kinder insgesamt eher wenig. Sie befinden sich in einer Art »asymmetrischem System«, in dem »Geben« und »Bekommen« nicht in Balance sind. Menschen sind als soziale Wesen auf »Ausgleich« ausgerichtet – auch in ihren Kontakten untereinander. Im Kontakt mit autistischen Menschen kann die Entwicklung dieses »Ausgleichs« erschwert sein, sodass der Kontakt mit ihnen auch eine anstrengende und auslaugende Erfahrung bedeuten kann.
Als fordernd in diesem Zusammenhang wird von Familien mit autistischen Kindern auch erlebt, dass bestimmte Prozesse im Rahmen der Entwicklung ihrer Kinder anders verlaufen als erwartet. Schirmer nennt als Beispiel dafür, dass diese Kinder nicht wie andere »ihren Freundeskreis sukzessive so weit aufbauen, dass ihnen ein Netzwerk außerhalb des Familienzusammenhaltes zur Verfügung steht.« (2015, 49). Für die betroffenen Familien hat dies teilweise auch sehr direkte Auswirkungen auf den Alltag – beispielsweise, dass Zeiten fehlen, in denen die Kinder sich mit ihren Freunden beschäftigen und den Eltern auf diese Weise eine »Pause« verschaffen.
Читать дальше