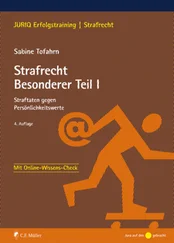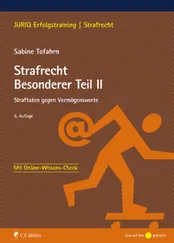Übungsfälle:
Krahl , Streit um einen Parkplatz, JuS 2003, 1187 (versuchte schwere Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft); Reschke , Gefährliche Patientenversuche, JuS 2011, 50 (die Wichtigkeit eines Gliedes gem. § 226 I Nr. 2 StGB).
Rechtsprechung:
BGHSt 24, 315– Schneidezähne (keine dauernde Entstellung bei Prothese); BGHSt 28, 100– Niere (inneres Organ als wichtiges Glied); BGHSt 51, 252– Finger (wichtiges Glied); BGHSt 62, 36– Finger (dauerhafte Gebrauchsunfähigkeit nach verweigerter Behandlung).
IV.Körperverletzung mit Todesfolge, § 227
1.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
227§ 227 stellt eine Erfolgsqualifikationi. S. d. § 18 zu § 223 dar. Zusätzlich zur vorsätzlich begangenen Körperverletzung muss der Täter den Tod des Opfers wenigstens durch fahrlässiges Verhalten verursacht haben 468. Die Vorschrift setzt sich damit aus einer vorsätzlichen Körperverletzung und einer fahrlässigen Tötung zusammen. Der gegenüber §§ 223, 222, 52 erhöhte Strafrahmen lässt sich nur damit erklären, dass in den Fällen des § 227 die vorsätzliche Körperverletzung und die fahrlässige Tötung nicht nur tateinheitlich zusammenfallen, sondern sich im Tod gerade die spezifische Gefahr des Körperverletzungsdelikts realisiert und durch diese innere Verknüpfung ein gesteigerter Unwertsgehalt verwirklicht ist 469.
228  Prüfungsschema
Prüfungsschema
1. Tatbestand
a) Verwirklichung des Grundtatbestands des § 223
aa) Objektiver Tatbestand: Körperliche Misshandlung (Var. 1) oder Gesundheitsschädigung (Var. 2)
bb) Subjektiver Tatbestand: Vorsatz
b) Erfolgsqualifikation i. S. d. § 18
aa) Eintritt der schweren Folge: Tod
bb) Kausalität zwischen Handlung und schwerer Folge
cc) Wenigstens Fahrlässigkeit hinsichtlich der schweren Folge
dd) Objektive Zurechnung der schweren Folge
ee) Gefahrspezifischer Zusammenhang zwischen Grundtatbestand und schwerer Folge
2. Rechtswidrigkeit
3. Schuld, insb. auch subjektive Vorhersehbarkeit des Erfolges
 Klausurtipp
Klausurtipp
Soweit § 212 (§ 211) verwirklicht ist, ist § 227 nicht mehr zu prüfen, da die Vorschrift dann im Wege der Gesetzeskonkurrenz verdrängt wird. Im Übrigen wird es sich bisweilen empfehlen, zunächst den Grundtatbestand des § 223 vorab zu prüfen (Prüfungsaufbau: I. § 223, II. § 227). Liegt der Grundtatbestand weder in Vollendung noch im Versuch vor oder sind Rechtfertigungs- bzw. Entschuldigungsgründe gegeben, so ist auch die Erfolgsqualifikation zu verneinen. Bedeutung kann dies etwa haben, wenn es zunächst die Einwilligung in eine ärztliche Heilbehandlung zu diskutieren gilt. Es ist dann aber ggf. noch § 222 zu prüfen. Ansonsten können der Grundtatbestand und das erfolgsqualifizierte Delikt auch kombiniert geprüft werden. Ist eine Strafbarkeit nach § 227 zu bejahen, muss § 222 nicht mehr angesprochen werden, da das Delikt dann im Wege der Gesetzeskonkurrenz verdrängt wird.
229 a) Allgemeine Voraussetzungen des erfolgsqualifizierten Delikts.Zunächst sind die Grundsätze der Kausalitätund der objektiven Zurechnungzu beachten. Für die Kausalität genügt dabei, dass der Eintritt des Erfolges durch die Verletzungshandlungen zumindest beschleunigt wird. Darüber hinaus muss sich im Erfolg auch die spezifische Gefahr des Grundtatbestandesder Körperverletzung niedergeschlagen haben. Dabei ist es für die Lösung von Sachfragen nicht von entscheidender Bedeutung, ob man den gefahrspezifischen Zusammenhang als eigenständigen Prüfungspunkt oder nur als eine spezielle Ausprägung der objektiven Zurechnung ansieht. Die im Übrigen erforderliche Fahrlässigkeitist grundsätzlich in der vorsätzlichen Verletzungshandlung, d. h. der Verwirklichung des Grundtatbestandes, zu sehen 470. Dabei muss die tödliche Folge objektiv und subjektiv vorhersehbar sein, wozu es nach Ansicht des BGH ausreicht, dass der Geschehensablauf in seinen wesentlichen Zügen erkennbar ist, ohne dass es auf die Details des Kausalverlaufs ankommen soll 471.
230 Bsp.: 472T tritt den O mit dem Fuß kräftig in den Oberkörper. Möglicherweise begünstigt durch die Alkoholisierung und eine Vorschädigung des Herzmuskels führt die Reizung des Solarplexus zum Herzstillstand und damit zum Tod des O.
Nach Ansicht des BGH steht es der Strafbarkeit nicht entgegen, dass die Todesursache eine „medizinische Rarität“sei. Es komme nur darauf an, ob der Täter den Tod im Allgemeinen voraussehen könne; dies sei der Fall, da bei Tritten in den Oberkörper das Risiko eines tödlichen Ausganges etwa durch einen Leber- oder Milzriss bestehe 473. Möchte man die Begrenzungen der Haftung durch den gefahrspezifischen Zusammenhang nicht aushöhlen, überzeugt dies jedoch nicht, da sich dann die Vorhersehbarkeit auf ein ganz anderes (hypothetisch gebliebenes) Risiko als dasjenige, das sich im Erfolg realisiert hat, erstrecken würde 474. Andererseits ist jedoch auch nicht Voraussetzung, dass der Täter innerhalb des von ihm geschaffenen Risikos die körperlichen Vorgänge im Einzelnen vorhersieht 475.
231 b) Der gefahrspezifische Zusammenhang im Speziellen.Im Tod muss sich die spezifische Gefahr desjenigen Aktes niedergeschlagen haben, der als Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeitsprüfung gewählt wird.
232 aa)Insoweit ist vor allem streitig, ob die schwere Folge des Todes zwingend auf dem konkreten Körperverletzungserfolg beruhen muss (Letalitätslehre) 476, oder hiervon nur eine Ausnahme zu machen ist, wenn § 224 Abs. 1 Nr. 5 als Grunddelikt verwirklicht ist 477, oder ob auch die der Körperverletzungshandlung innewohnende Gefahrausreichend sein kann 478.
Bsp.: 479T schlägt O mit der Pistole auf den Kopf, um ihn zu verletzen; dabei löst sich ein Schuss; O kommt zu Tode. – Bei der Beurteilung des gefahrspezifischen Zusammenhangs ist problematisch, dass der Tod nicht auf dem herbeigeführten Körperverletzungserfolg (Kopfverletzung), sondern auf der Körperverletzungshandlung (Verwenden der Pistole) beruht. Der klassische Fall des § 227 läge vor, wenn T an den Folgen des Schlages auf den Kopf verstorben wäre.
233Der von der Letalitätslehreangeführte Wortlaut und der Hinweis auf das Erfordernis einer restriktiven Tatbestandsauslegung 480vermögen nicht zu überzeugen. Der Begriff der Körperverletzung beschreibt nämlich nicht nur den Erfolg, sondern enthält – wie die körperliche Misshandlung i. S. d. § 223 Abs. 1 Var. 1 zeigt – zugleich ein Handlungsmoment („üble und unangemessene Behandlung…“). Auch ist zu beachten, dass der Körperverletzungshandlung ggf. sogar ein größeres Gefahrenmoment anhaften kann und aus diesem Grund kein Bedürfnis für eine solch restriktive Auslegung besteht. Letztlich bezieht sich § 227 auf §§ 223 ff. insgesamt und damit auch auf die in Abs. 2 normierte Versuchsstrafbarkeit, bei der gerade kein tatbestandlicher Erfolg gegeben ist 481. Im Beispielsfall kann daher § 227 Anwendung finden. Die Gegenansicht würde nur zu einer Strafbarkeit gem. §§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2, 5 (hinsichtlich des Schlages) in Tateinheit mit § 222 (hinsichtlich des Schusses) gelangen.
Читать дальше
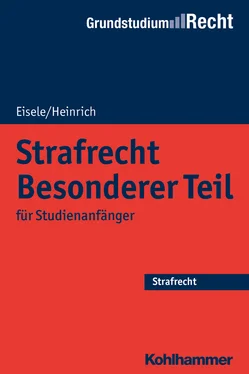
 Prüfungsschema
Prüfungsschema Klausurtipp
Klausurtipp