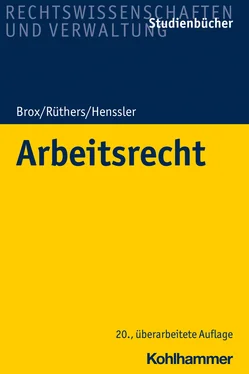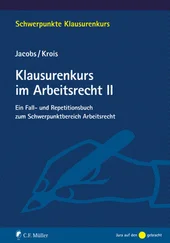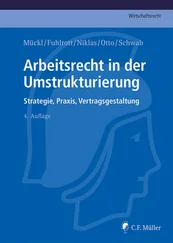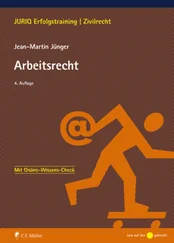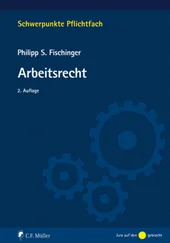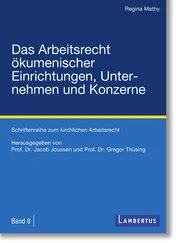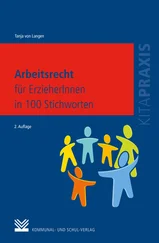90Vor dem Abschluss eines Arbeitsvertrags können beide Seiten ein Interesse daran haben, die Eignung und Neigung des Arbeitnehmers für die vorgesehenen Arbeitsaufgaben zu erproben. Das geltende Recht eröffnet dafür verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten:
• Abschluss eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit gleichzeitig vereinbarter, anfänglicher, befristeter Probezeit. Sie beträgt in der Regel, nicht zuletzt im Hinblick auf § 1 Abs. 1 KSchG, sechs Monate. Wird diese Probezeit nicht als Mindestvertragsdauer vereinbart, so kann das Arbeitsverhältnis während der Probezeit von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden (§ 622 Abs. 3 BGB).
• Abschluss eines befristeten Probearbeitsverhältnisses. Sachgrund und Zweck der kalendermäßigen Befristung ist die Erprobung (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 TzBfG). Die Befristung bedarf der Schriftform (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Das befristete Probearbeitsverhältnis endet mit dem Ablauf der vereinbarten Frist. Eine ordentliche Kündigung innerhalb der vereinbarten Frist ist nur möglich, wenn dies vereinbart wurde (§ 15 Abs. 3 TzBfG).
C.Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse
Schrifttum: Bodem , Abwicklung gescheiterter freier Mitarbeiterverhältnisse aus arbeits-, sozial-, steuer- und strafrechtlicher Sicht, ArbRAktuell 2012, 213; Rebhahn , Arbeitnehmerähnliche Personen – Rechtsvergleich und Regelungsperspektive, RdA 2009, 236; Reiserer , Wege aus dem Arbeitsverhältnis in die Selbstständigkeit, in: Festschrift 25 Jahre ARGE ArbR im DAV, 2006, S. 545.; Schubert , Der Schutz arbeitnehmerähnlicher Personen, 2004; Willemsen/Müntefering , Begriff und Rechtsstellung arbeitnehmerähnlicher Personen: Versuch einer Präzisierung, NZA 2008, 193.
I.Der Begriff der arbeitnehmerähnlichen Person
91Es gibt Rechtsverhältnisse, die keine Arbeitsverhältnisse darstellen; dennoch befindet sich eine der beiden Vertragsparteien wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem Unternehmer in einer ähnlichen Lage wie ein Arbeitnehmer. Das kann dazu führen, dass diese Personen in bestimmten Bereichen ebenso schutzbedürftig sind wie die Arbeitnehmer. An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit tritt die wirtschaftliche Unselbstständigkeit (BAG AP Nr. 12 zu § 611 BGB Arbeitnehmerähnlichkeit). Diese Beschäftigten werden als arbeitnehmerähnliche Personen bezeichnet und Arbeitnehmern im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes (§§ 2, 12 BUrlG), des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 AGG), des Pflegezeitgesetzes (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 PflegeZG); des Arbeitsgerichtsgesetzes (§ 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG) und des Tarifvertragsgesetzes (§ 12a TVG) gleichgestellt. Eine Legaldefinition des Arbeitnehmerähnlichen kennt § 12a TVG, der ihn für Personen verwendet, die „wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einem Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig“ sind. Traditionell werden die Heimarbeiter, die Handelsvertreter und die Freien Mitarbeiter zu den Arbeitnehmerähnlichen gezählt. Insgesamt ist der arbeitsrechtliche Schutz dieser Personengruppe gesetzlich nur sehr gering ausgeprägt. Insbesondere genießen ihre Mitglieder weder Kündigungsschutz noch Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Eine Inhaltskontrolle der Dienst- oder Werkverträge gem. §§ 305 ff. BGB findet hingegen statt; außerdem ist der besondere Diskriminierungsschutz des AGG anwendbar (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 3 AGG). Im Einzelfall umstritten ist die analoge Anwendung konkreter arbeitsrechtlicher Vorschriften (dazu HWK/Thüsing, § 611a BGB Rdnr. 125).
92Eine arbeitnehmerähnliche Person kann als im sozialversicherungsrechtlichen Sinn „Selbstständig Tätiger“ in vollem Umfang rentenversicherungspflichtig sein (§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI). Mit Blick auf die fortschreitende Modernisierung der Arbeitswelt steht das Arbeitsrecht vor der Herausforderung, angemessene Regelungen für Arbeitskräfte anzubieten, die sich aufgrund der Art ihrer Beschäftigung weder als Arbeitnehmer noch eindeutig als Selbstständige qualifizieren lassen. Hierzu bietet es sich an, das Recht der arbeitnehmerähnlichen Personen maßvoll auszubauen (dazu Rdnr. 1243).
II.Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende
93Für die Heimarbeiter und die Hausgewerbetreibenden enthält das Heimarbeitsgesetz Vorschriften über Arbeitszeit, Gefahren, Entgelt- und Kündigungsschutz (§§ 10 f., 12 ff., 17 ff., 29 f. HAG). Ergänzend sieht das EFZG für Heimarbeiter im Krankheitsfall einen Anspruch auf einen Zuschlag zum Arbeitsentgelt vor (§ 10 EFZG).
a) Heimarbeiter ist, wer in selbstgewählter Wohnung oder Betriebsstätte allein oder mit Familienangehörigen im Auftrag von Gewerbetreibenden gewerblich arbeitet und die Verwertung der Arbeitsergebnisse dem Gewerbetreibenden überlässt (vgl. § 2 Abs. 1 HAG). Das BetrVG fingiert, dass Heimarbeiter als Arbeitnehmer des Betriebes gelten, für den sie in der Hauptsache arbeiten (§ 5 Abs. 1 Satz 2 BetrVG).
b) Der Hausgewerbetreibende unterscheidet sich vom Heimarbeiter dadurch, dass er (höchstens zwei) fremde Hilfskräfte oder Heimarbeiter beschäftigt, wobei er „selbst wesentlich am Stück mitarbeitet“ (vgl. § 2 Abs. 2 HAG).
94Das Heimarbeitsrecht hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv an Bedeutung verloren. Heute fallen lediglich noch ca. 20.000 Beschäftigte unter dieses Gesetz. Möglicherweise stellt jedoch das Urteil des BAG aus dem Jahr 2016 einen gewissen Wendepunkt dar (NZA 2016, 1453). Das Gericht hat – allerdings in einem eher atypisch gelagerten Fall – die Anwendbarkeit des HAG auf einen seit längerem für ein Unternehmen tätigen Softwareentwickler bejaht. Das Heimarbeitsrecht ist so in den Fokus der Überlegungen zur arbeitsrechtlichen Behandlung neuartiger, digitaler Beschäftigungsmöglichkeiten gerückt (sog. Arbeit 4.0., hierzu Rdnr. 1240 ff.).
95Der Handelsvertreter ist selbstständiger Kaufmann (vgl. § 84 Abs. 1 HGB) und daher kein Arbeitnehmer. Darf er nur für einen Unternehmer tätig werden (sog. Einfirmenvertreter, vgl. § 92a HGB) und hat er in den letzten sechs Monaten durchschnittlich nicht mehr als 1.000,– Euro monatlich verdient, sind für seine Rechtsstreitigkeiten mit dem Unternehmer die Arbeitsgerichte zuständig (vgl. § 5 Abs. 3 ArbGG).
96Sofern es sich bei einem als „Freier Mitarbeiter“ bezeichneten Beschäftigten nicht aufgrund persönlicher Abhängigkeit um einen Arbeitnehmer handelt ( Fall d; Rdnr. 52), wird er doch häufig jedenfalls wirtschaftlich vom Unternehmer abhängig sein, weil er im Wesentlichen nur für ihn tätig ist und das bei ihm verdiente Entgelt seine Existenzgrundlage bildet. In diesem Fall sind die oben (Rdnr. 91) genannten Vorschriften auf sein Vertragsverhältnis anwendbar.
97Die bislang genannten, schon seit langem anerkannten Gruppen der Arbeitnehmerähnlichen sind um den Franchisenehmer zu ergänzen. Sowohl das BAG (AP Nr. 37 zu § 5 ArbGG 1979) als auch der BGH (BGHZ 140, 11) haben die Arbeitnehmerähnlichkeit dieser Vertriebspartner mit einer pauschalen Begründung bejaht (im Übrigen oben Rdnr. 56).
Kapitel 2:Die rechtlichen Grundlagen des Arbeitsverhältnisses
98Das Arbeitsverhältnis unterliegt heute nicht mehr allein oder auch nur vorrangig nationalem Arbeitsrecht. Es herrscht eine Gemengelage von internationalen (teils supranationalen) (Rdnr. 100 ff.) und nationalen (Rdnr. 121 ff.) Rechtsregeln. Der Begriff „Internationales Arbeitsrecht“ kann zwei Bedeutungen haben. Er bezeichnet zunächst jenen Teil des Völkerrechts, der die zwischenstaatlichen Vereinbarungen von sozialen Schutznormen für Arbeitnehmer behandelt. Das sind insbesondere die zahlreichen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (Rdnr. 100 f.). Dieser auch als supranationales Arbeitsrecht bezeichnete Teil des Arbeitsrechts gilt über die Grenzen eines Staates hinaus. Als Arbeitskollisionsrecht wird jene Teildisziplin des (deutschen) internationalen Privatrechts bezeichnet, die die Frage behandelt, welches nationale Arbeitsrecht auf Arbeitsverhältnisse mit Auslandsberührung anzuwenden ist (Rdnr. 161 ff.). In den letzten Jahrzehnten hat das Recht der Europäischen Union im Arbeitsrecht erheblich an Bedeutung gewonnen und durchdringt heute weite Teile des nationalen Arbeitsrechts. Die Klärung offener Rechtsfragen erfolgt daher häufig nicht mehr in Erfurt (BAG), sondern in Luxemburg beim EuGH.
Читать дальше