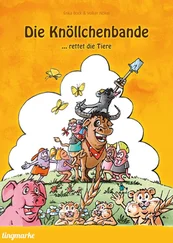Zwei Möglichkeiten sind uns damit begegnet, wie der Mensch auf das Erlebnis einer grundlegend fremden Natur zu reagieren vermag. Schneiders literarische Option für eine geteilte Wirklichkeit dürfte im Alltag wahrscheinlich nur selten über den Status einer erkenntnistheoretischen Perspektive hinausgekommen sein. Wer sich aufmerksam umschaut, entdeckt aber gerade im alltäglichen menschlichen Umgang mit den Tieren, dass Conrads geheimnisvoller Agent Kurtz allgegenwärtig zu sein scheint.
„Warum hatte er auch nichts aus ihrem Schicksal gelernt?“
Viele menschliche Praktiken im Umgang mit Tieren zehren von der abgründigen Erfahrung einer sinnwidrigen Natur, auch wenn dies nicht immer offensichtlich zu Tage tritt. Wie für Kurtz könnte auch für viele heutige Menschen gelten, dass sie, wie Anton Fürlinger es formuliert, immer noch „wild at heart“ sind; und er ergänzt einschränkend: „But because we were so often on the menu we are not so perfect hunters and killers.“ 14Aber stimmt das wirklich? Gerade weil wir keine Gejagten mehr sind, so könnte man dagegen einwenden, verstehen wir uns doch offenbar umso besser auf das Töten von Tieren. Sind wir mit anderen Worten etwa erst durch die vermeintliche Flucht aus der Natur in die Kultur zu jenen Killertieren geworden, die heute so selbstverständlich töten? So ist etwa die Jagd auf die Tiere ein nur schwer zu ertragendes Kapitel der Menschheitsgeschichte, selbst dort, wo sie von solch begnadeten Erzählerinnen wie einer Karen bzw. Tanja Blixen vorgetragen wird. In ihrem Epos „Jenseits von Afrika“ (1937) gehört das Töten von Tieren, ihr nahezu beiläufiges Sterben, zum Alltag. Einmal schildert sie, wie sie zusammen mit einem Freund zunächst eine Löwin, dann einen Löwen erschießt, die zuvor eine Giraffe getötet hatten:
„Der Löwe blieb reglos stehen, während ich aus dem Wagen stieg und ein paar Schritte auf ihn zuging. Ich drückte ab, und mir schien, als würde er senkrecht in die Höhe springen und danach mit geschlossenen Beinen auf dem Boden landen. Ich stand im Gras, mit der Flinte in der Hand, und holte tief Atem, durchglüht von jenem Gefühl der Macht, das einem Schutz verleiht, weil man auf weite Entfernung eine große Wirkung erreicht. […] Die Giraffe wirkte ungeheuer groß und streng, mit ihren vier riesigen steifen Beinen, dem steifen ausgestreckten Hals und dem von den Löwen aufgerissenen Bauch. Die Löwin lag auf dem Rücken, mit einem breiten, hochmütigen und triumphierenden Grinsen im Gesicht, sie war ganz offensichtlich die Femme fatal der Tragödie. Der Löwe lag nicht weit von ihr entfernt, und warum hatte er auch nichts aus ihrem Schicksal gelernt? Sein Kopf ruhte auf den beiden schweren Vorderpfoten, die gewaltige dunkle Mähne war wie ein Königsmantel über ihn ausgebreitet, und jetzt war es so hell geworden, dass der Grasfleck, auf dem er lag, dunkelrot glänzte.“ 15
Der Blick der toten Tiere offenbart hier auch etwas über den Blick der Menschen: Das tote Tier ist die ultimative Selbstvergewisserung der eigenen, zudem als machtvoll erfahrenen Lebendigkeit. Ich bin kein Tier – das heißt eben auch: Ich bin – kein Tier ist. Kein Tier kann sein, wenn ich sein soll. Es ist nicht die Tragödie der Tiere, von der Blixen hier spricht, sondern die Urtragödie des Menschen selbst, dem das Fremde und Andere zur ultimativen Bedrohung wird, weil wir insgeheim immer schon ahnen, dass das Fremde stets ein unerträglicher Reflex des Eigenen zu sein vermag. Die Jagd des Menschen auf die Tiere ist möglicherweise ein treffender Beleg dafür, wie brüchig und verschwommen doch gerade die Grenze zwischen den Wesen ist. Das triumphalistische Töten dient der immer wieder aufs Neue vorzunehmenden kosmetischen Korrektur dieser verschwommenen Trennlinie. Die Pragmatik des Tötens soll belegen, was in der Erfahrung längst verloren gegangen ist: jene trennende Glasmembran, von der Reinhold Schneider schreibt. Sobald sie fällt, wird das Andere gerade deswegen zur Bedrohung, weil es dem Eigenen so gespenstisch ähnlich ist.
Viel hängt deswegen davon ab, wie viel Zwangsläufigkeit wir dieser konfrontativen Konstellation von Ich und Du, Eigenem und Fremdem zuschreiben wollen, und ob ein solches Gegenüber notwendigerweise Gewalt befördert. Auch viele spätere Deutungen greifen diese kriegerische Opposition von Ich und Du auf und stilisieren sie zum alternativlosen Drama des Lebendigen schlechthin – der Krieg aller gegen alle , der homo homini lupus , verschiedenste sozialdarwinistische Verästelungen der Evolutionstheorie, selbst die Spieltheorie setzt auf die Produktivität dieses Gegensatzpaares. Für das zukünftige Verhältnis von Menschen und Tieren wird es von entscheidender Bedeutung sein, ob wir weiterhin bereit sind, diesem scheinbar alternativlosen Mantra zuzustimmen: Wenn Du bist, kann ich nicht sein – und vice versa : Wenn Ich sein soll, kannst Du nicht sein.
Die Bedrohung durch den Anderen schlechthin
Es gibt in dieser Diskussion eine interessante Parallele in der Theologie: Dies liegt schon deswegen nahe, weil ja gerade die zweite Schöpfungserzählung der Bibel und damit verbunden die Erzählung vom sog. Sündenfall gleichermaßen als Verhältnisbestimmung zwischen einem Ich und einem Du gelesen werden kann. Auch wenn der Begriff der Sünde im biblischen Text selbst gar nicht vorkommt, erwächst das dort geschilderte Böse aus einem grundlegenden Misstrauen vor dem jeweils anderen und führt in der Konsequenz zur Verfeindung von Mensch und Mitmensch, Mensch und Tier, Mensch und Gott.
Entscheidender dürfte aber noch ein weiterer Aspekt sein: Insbesondere die moderne Theologie hat darauf hingewiesen, dass auch Gott selbst zu häufig als der Andere gedacht und von Theologie und Kirche verkündet wurde. Selbst die eigentlich trinitarisch verfasste Theologie des Christentums hat sich häufig genug dualistisch geriert und die Gegensatzpaare von Schöpfer und Schöpfung, Gott und Mensch, Himmel und Erde, Natur und Gnade usf. zur Strukturierung ihrer Theoriegebäude aufgegriffen. Sie schienen geeignet, das erste Gebot zu wahren – keine anderen Götter zu verehren, das bedeutet schließlich auch: Nichts Weltliches darf vergöttlicht werden, die Grenze zwischen den Gegensätzen muss möglichst klar bleiben. Der bedrohliche Gegensatz von Ich und Du, Eigenem und Fremdem liegt gleichermaßen darin. Romano Guardini, sicher einer der weisesten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat eindringlich vor der Gefahr einer solchen Theologie gewarnt: Sie besteht darin, dass Gott in diesem Denken als der Andere schlechthin begriffen wird. Diese denkerische Grundlegung führt dazu, dass der Mensch zu Recht aufbegehrt:
„Mein Selbst kann nicht unter der Gewalt des Anderen stehen, auch nicht, wenn dieser Andere Gott ist. […] Und zwar nicht deshalb, weil meine Person vollkommen wäre und darum die andere nicht über sich ertrüge, sondern gerade weil sie das nicht ist. Gerade weil mein Selbst nicht wirklich und sicher in sich steht, wird ihm die Anwesenheitswucht des Anderen gefährlich. […] Dann kommt das Gefühl: Er oder ich! […] Daraus kommt der ‚postulatorische Atheismus‘: Wenn ich sein soll, kann er nicht sein.“ 16
Guardini sieht etwas sehr Wichtiges: Eine bestimmte Art, Gott zu denken, führt paradoxerweise zur Unmöglichkeit, Gott angemessen zu denken – der Theismus kippt in sein Gegenteil, den Atheismus. Etwas ganz Analoges erleben wir heute, wenn wir versuchen zu verstehen, wie wir bislang über Lebendigkeit, über lebendige Wesen nachgedacht haben. Die Tatsache, dass wir selbst heute noch von anderen Lebewesen als Objekten denken, im wörtlichen Sinne also als Wesen, die uns gegenübergestellt sind, bezeugt doch, dass auch wir immer noch der Fundamentalopposition von Ich und Du anhängen. Nahezu alle natur- und tierphilosophischen Ansätze der nächsten Jahre werden sich die Frage stellen müssen, welche Alternativen es zu jener radikalen Gegenüberstellung von Ich und Du geben kann, wenn ihnen daran gelegen ist, den Dauerkriegszustand zwischen den lebendigen Wesen zu beenden. Für die Theologie und die Gottesfrage vermerkt Guardini: „Gott ist nicht ‚der Andere‘, sondern Gott“, und er ergänzt: „Daran, dass das erkannt wird, hängt die Erkenntnis der Schöpfung und das Selbstverständnis des Menschen.“ 17Das Kernproblem des Theismus kennzeichnet Guardini hier also dadurch, dass Gott als der Andere des Menschen erscheint bzw. so ausgelegt wird. Guardini betont deswegen:
Читать дальше