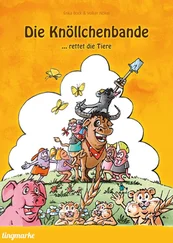„[…] krepieren sozusagen den seichteren Tod, / verlieren – wir wollen es glauben – weniger Welt und Fühlen, / verlassen – so will uns scheinen – eine weniger tragische Bühne.“
Und nur kurz darauf heißt es dann von dem toten Käfer: „Er liegt, als wäre ihm nichts von Bedeutung passiert.“ Diesem Mantra eines bedeutungslosen Sterbens und Verschwindens der Tiere folgt unsere Gesellschaft bis heute. Mögen Darwin und mit ihm die neueren Evolutionstheorien die Grenze zwischen den Arten noch so sehr eingeebnet haben, spätestens wenn es ans Sterben geht, zelebrieren wir bis heute die doppelte Metaphysik eines bedeutungslosen, weil tierlichen Todes auf der einen und den metaphysischen Staatsakt menschlichen Sterbens auf der anderen Seite. Inwieweit sich durch die zunehmenden Möglichkeiten und Formen von Tierbestattungen eine Trendwende abzeichnet, bleibt abzuwarten.
Es ist daher aufschlussreich, die Gründe für die Instandsetzung und die jahrhundertelange, penible Wartung dieser fundamentalen Grenze zu suchen, über die keine Brücke zu führen scheint. Was genau schützt eine solche Sprachnorm, die den Menschen das Sterben exklusiv zuspricht und damit zugleich andeutet, dass dieses Sterben besonders, womöglich nicht endgültig sei? Wenn es umgekehrt betrachtet stimmen sollte, dass Tiere sterben (und eben nicht „verenden“), dann definieren sich beide Begriffe nahezu gegenseitig. Am sterbenden Tier lernt der moderne Mensch eine der schmerzlichsten Lektionen des Lebens, vor der ihn die Rede vom Verenden der Tiere nach Möglichkeit zu bewahren sucht: Tiere sterben – und was stirbt, ist – so der unaussprechbare Verdacht – vielleicht auch ein Tier? Das Eigenleben der Begriffe, die eine solche Conclusio ermöglichen, rührt an die tiefsten Ebenen des menschlichen Bewusstseins und präsentiert eine schiere Ungeheuerlichkeit: Mit den Tieren sterben immer auch die Menschen. Selbst wir fühlen im Angesicht sterbender Tiere jenes urtümliche Erschrecken: Blickt uns aus den Winkeln der Tieraugen etwa das Nichts an? Erkennt der menschliche Blick in den sterbenden Tieren jenen Mangel an Sein, eine Spur jenes Nichts, aus dem doch letztlich beide hervorgerufen wurden?
Grund zu einer kritiklosen Naturemphase gibt es wahrlich nicht; der Anblick toter oder sterbender Tiere dürfte die schnellste Kur gegen derart blumige Naturromantizismen sein. Schönheit und Schrecken gehen in dem, was wir „Natur“ nennen, ineinander über. Unsere Wahrnehmung kippt mitunter von einer Sekunde auf die nächste, und was zuvor schön und erhaben schien, gibt sich sogleich als urtümliches Grauen einer alles zermalmenden Wirklichkeit zu erkennen. Oft lassen sich beide Eindrücke aber auch gar nicht voneinander trennen, wie jeder weiß, der nur einmal aufmerksam einen Strand abgeschritten ist. Die sandigen Küstenabschnitte, die so erhaben auf uns wirken, sind doch immer auch die zertretenen Grabstätten von unzähligen Muscheln, deren Kalkhüllen sich hier mit den Gesteinsstückchen feinsten Sandes mischen. Es wäre zumindest nicht falsch zu behaupten, dass jene Küstenstreifen unüberschaubaren Friedhofsarealen gleichen. Ergriffenheit und Erschütterung gehen Hand in Hand in der Erfahrung dessen, was wir landläufig Natur nennen; in ihr scheint die Ambivalenz von Sterben und Lebendigkeit zutiefst verwoben zu sein. In unserer Erfahrung mit den Tieren scheint sich diese irritierende Erfahrung bis ins Unerträgliche zuzuspitzen.
Eine Reise ins Herz der Finsternis
Die großen Tiernarrative der Moderne lassen sich auf zwei wesentliche Formeln bringen: Tiere sind dem Menschen Sinnbild für die pure Lebendigkeit, die überbordende Fülle und wilde Freude des Lebens, die glückselige Unmittelbarkeit jener Gebundenheit an den Pflock des Augenblicks, von der Nietzsche beinahe sehnsüchtig sprach. 4Zugleich konfrontieren sie ihn mit dem Schrecken der Kontingenz, der Leere und der Auslöschung des Lebens. Unter den Händen sterben uns die Tiere weg, widersetzen sich dem Wunsch selbst der ihnen wohlgesonnenen Menschen; eine letzte Spritze vom Tierarzt ins Herz einer Katze, und was zuvor lebte, ist vergangen. Ein solches Verschwinden ist selbst fast ein Nichts, das Wegbrechen des Lebendigen innerhalb eines einzigen Augenblicks; und wer erst einmal erlebt hat, wie jemand derart ins Nichts verschwindet, dem ist eben dieses Nichts bereits auf den Fersen.
Den horror vacui , das Entsetzen angesichts eines solchen Nichts, hat niemand eindrucksvoller beschrieben als Joseph Conrad: Sein wohl bekanntester Kurzroman „Herz der Finsternis“ (1899) trägt ein Bild für jenes Grauen vor dem Abgrund des Nichts im Titel. 5Er schildert die Begegnung mit der afrikanischen Wildnis, die sich trotz all ihrer anfänglichen Schönheit jeglichem Sinn konsequent entzieht. Conrads Protagonist, der Seemann Marlow, soll entlang des Kongos einen Mann namens Kurtz ausfindig machen. Der ehemalige Menschenfreund gilt mittlerweile als brutales Ungeheuer: „Unter den Teufeln des Landes hatte er einen der obersten Plätze eingenommen“ 6– tyrannisch, durchtrieben und mit unvorstellbarer Gewalt regiert er das von ihm eroberte Gebiet. Die Eingeborenen, die Kurtz trotz – oder wegen? – seiner Grausamkeiten als einen Zauberer verehren, wollen ihn zunächst nicht gehen lassen. Kurtz stirbt schließlich auf der beschwerlichen Rückreise und haucht mit einem Fensterblick in die Wildnis seine letzten – berühmt gewordenen – Worte: „Das Grauen, das Grauen!“ 7Die jahrelange Konfrontation mit der Wildnis im tiefsten Herzen Afrikas hat, so deutet es Marlow halb beängstigt, halb beeindruckt, offenbar Besitz von Kurtz ergriffen. Man missversteht diese Übereignung aber, wenn man sie so auffasst, dass Kurtz ganz einfach Kultur gegen Natur, Zivilisation gegen Wildnis eingetauscht und demnach einen bloßen Wechsel des Herrschaftsprogramms vollzogen hätte. Es ist komplizierter: Das Grauen, das Kurtz ergreift, ist das schiere Entsetzen angesichts einer Wildnis, die in all ihrer lebendigen, farbenfrohen Vielfalt jeglichen Sinn verweigert. Ihr beständiges Raunen, Plätschern, Zirpen und Rufen ist für Kurtz nicht mehr als ein nur oberflächlich überspieltes Schweigen, und die Kontingenz, die Nicht-Notwendigkeit dessen, was in ihr ist, nur die grausige Kehrseite dieser lebendigen Vielfalt. So sieht es schließlich auch Marlow:
„Ich glaube, am Ende wusste er davon – erst ganz am Ende. Aber die Wildnis hatte ihn frühzeitig erkannt, und sie hat für die groteske Invasion furchtbare Rache an ihm genommen. Ich glaube, sie hatte ihm Dinge über sich selbst zugeflüstert, von denen er nicht wusste, Dinge, deren er sich nicht bewusst war, bis er mit dieser tiefen Einsicht zu Rate ging – und dies Flüstern hatte eine unwiderstehliche Faszination auf ihn ausgeübt. Es hallte dröhnend in ihm wider, denn er war im Innern hohl.“ 8
Kurtz, der der Wildnis so lange gelauscht hat, ist in gewissem Sinne nur das konsequente, zugleich wahnsinnig gewordene und doch geistig vollkommen klare Ergebnis jener ungezähmten Wirklichkeit, die in ihrem Herzen, im tiefsten Grund ihres Seins, das Nichts in sich trägt und bisweilen freizügig offenbart. Sie, die zum Subjekt evolvierte Natur, spiegelt jenes Sinnvakuum, das auch im Menschen entdeckt werden kann. Sie ist frei von jeder Botschaft, jeglichem tieferen Sinn, einzig pure Kontingenz, die demjenigen, der nur lang genug lauscht, auf erschütternde Weise mitteilt, dass sie ihm rein gar nichts mitzuteilen und zu bedeuten hat. Die natura loquitur , die sprechende Natur, von der vor allem das Mittelalter noch so verzückt war, wird spätestens bei Conrad einem Fundamentalverdacht ausgeliefert: Was wäre, wenn die Natur zwar spricht, aber nichts zu sagen hat?
„Etwas ist wirksam in uns, das uns wie mit Glas umschließt“
Tatsächlich kann auch das die Poesie der Wildnis sein: eine ängstigende Sinnlosigkeit im Gewand der verspieltesten, farbenprächtigsten Formen, ein Taumeln über dem Abgrund. Das „Herz der Finsternis“ ist ein wichtiger, wenngleich kein einfach zu verkraftender Ankerpunkt innerhalb einer natur- und tiersensiblen Literacy. Conrads Augenmerk gilt zwar weniger unmittelbar den Tieren als vielmehr der Wildnis an sich, erklärt aber einen zentralen menschlichen Impuls im Angesicht der Tiere: Wer den Blick des Lebendigen nur lange genug erwidert, erkennt darin ab einem bestimmten Punkt eine ganz ähnliche Kontingenz – vielleicht eine der beängstigendsten Urerfahrungen des Menschen mit der Natur und mit den Tieren. Wir sehen in ihnen bisweilen alles, aber auch wieder nichts. Diese Erfahrung steht irritierend quer zu den vereinnahmenden, euphorischen Ansätzen eines Naturverstehens und Nature Writing im Anthropozän, die jenes Zurück-zur-Natur-Motto predigen, das aus Conrad’scher Sicht zutiefst verschrecken muss – denn zurück zur Natur bedeutet in diesem Fall: zurück in eine amoralische, sinnwidrige Wirklichkeit, frei von jeglicher Orientierungsmöglichkeit, in der nichts Bedeutung hat, weil das Nichts regiert. Schon der große Vernunftdenker der deutschen Aufklärung, Immanuel Kant, erlebte den Schrecken dieses horror vacui , als er bei der Lektüre der Werke Herders erstmals die für ihn unvorstellbare Möglichkeit aufscheinen sah, dass die Ordnung der Arten auf dieser Welt nicht feststünde, dass sie nicht auf ein Ziel hinauslaufen könnte – der Schatten jener „geheimnißvolle[n] Dunkelheit, in welche die Natur selbst ihre Geschäfte der Organisation und die Classenvertheilung ihrer Geschöpfe einhüllte […]“. 9
Читать дальше