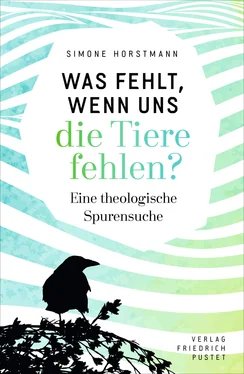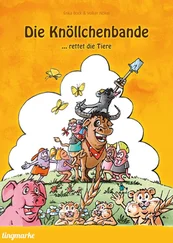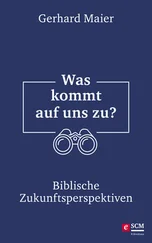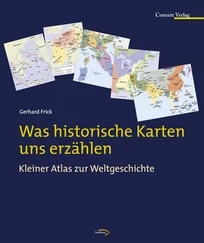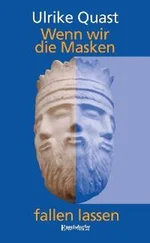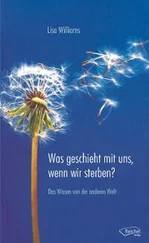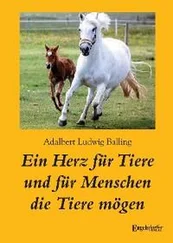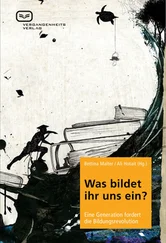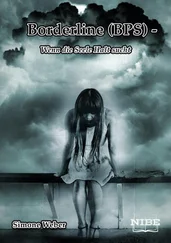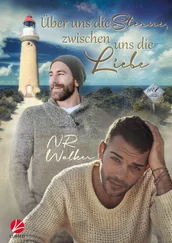Menschen als „Inter Spezies“-Wesen
Viele neuere Lebensentwürfe und soziale Bewegungen verstehen sich als dringend nötige Antworten auf die Folgen des Anthropozän. Neue Allianzen von Tier und Mensch werden sichtbar. Sie alle fürchten aus gutem Grund das, was noch nie war: die entsetzliche Möglichkeit einer zukünftigen Menschheitsgeschichte ohne die anderen Tiere.
Wir dürfen wohl annehmen, dass die Tiere dem Menschen nicht nur ein Apriori, die Bedingung aller Erfahrung, sondern zugleich die prima experientia , die erste und vielleicht fundamentalste Erfahrung waren. So betrachtet gab es den Menschen immer nur als Interspezies-Wesen: Er existierte und existiert bis heute nur als Wesen „inter-spezies“, also „zwischen den (anderen) Spezies“, ganz so, wie Darwins Skizze es erahnen lässt: umgeben und in der erlebten Nähe zu anderen lebendigen Tieren. Damit ist nicht der Versuch gemeint, ein weiteres Mal ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen formulieren zu wollen. Vielmehr geht es um die Erfahrung, dass etwas in den (anderen) Tieren in uns älteste Resonanzen auslöst und uns an eine urtümliche Nähe erinnert. Lange bevor die Rede von den Interspezies-Beziehungen zu einer normativen Forderung der neueren ökologischen Ethiken im Angesicht des drohenden Verschwindens unzähliger Arten und Individuen wurde, war sie eine angemessene Umschreibung für das menschliche Dasein zwischen den anderen Lebewesen. Dieses Buch ist daher auch eine Spurensuche: Es fragt in sechs unabhängig voneinander lesbaren Essays nach den vielfältigen Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren, nach der Dimension, der Wirklichkeit und Fassbarkeit des „Inter“ der Interspezies-Beziehungen.
Die Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe
Aus dieser Perspektive heraus fällt zugleich auf, dass die heute üblichen Klagen gerade dieses Moment der Verbundenheit außen vor lassen: Zwar kommt heute kaum ein Gärtner ohne den materialgewordenen Entschuldigungsgestus eines „Insektenhotels“ aus – ein letztes, beschauliches (und meist vollkommen fehlkonstruiertes) Refugium für jene Wildtiere, deren Namen wir längst vergessen haben, bildet nicht selten einen Ausdruck für die dem Menschen offenbar eigene Synthese aus Tatendrang und Hilflosigkeit. Und welche Großstädterin weiß heute nicht die „Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe“ zu rezitieren? Heute, so besagt diese omnipräsente Klage, kleben kaum noch tote Insekten an den Windschutzscheiben der Autos, mit denen wir zuvor unseren kilometerweiten Weg zur Arbeit und zurück hinter uns gebracht haben. Diese Klage übersieht einerseits nur allzu oft, dass sie mit dem beklagten Symptom auch zumindest eine Ursache für selbiges andeutet; andererseits liefert sie mit der „Windschutzscheibe“ eine grundehrliche Metapher, die Auskunft über das vorherrschende Verhältnis zwischen uns und den anderen Tieren gibt: Wir stehen ihnen demnach wie von einer gläsernen Scheibe getrennt gegenüber; von Verbundenheit kann hier keine Rede sein, obwohl die Metapher genau dies ja zugleich als einen Mangel beklagt. Wogegen richten sich also Versuche wie diese? Was genau fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? Die „Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe“ scheint jedenfalls darauf hinzudeuten, dass dieses Fehlen bereits real und greifbar geworden ist, und uns aber zugleich auch – fatalerweise – jene Mittel abhandengekommen sind, mit denen wir dieses Fehlen angemessen beschreiben können.
Aus diesem Grund ist es ein zentrales Anliegen dieses Buches, das „Fehlen“ der Tiere so zur Sprache zu bringen, dass es sich von den vorherrschenden Problembeschreibungen abhebt: Weder geht es hier um eine rein ökologische Betrachtung, die das Aussterben von Arten in das große Kalkül der Ökologie einbeziehen muss und als einen gesamtökologisch fatalen Schwund an Biodiversität deutet; noch geht es um eine letztlich ökonomisch gefärbte Variante dieses ökologischen Paradigmas, die vor einer Krise versiegender tierlicher Rohstoffe warnt. Ziel des Buches ist es vielmehr, die Angst vor einem Verlust der Tiere – als Individuen, als Arten, als den ganz Anderen und den ganz Vertrauten – in ihrer existentiellen Bedeutung zu erfassen.
Zum Stellenwert von (Tier-)Erfahrungen
Dies kann aber nur gelingen, wenn unsere Erfahrungen mit anderen Tieren einen anderen Stellenwert einnehmen, als dies bislang zumeist der Fall ist. Eben darauf hatte ja bereits die so verbreitete Metapher der Windschutzscheibe hingewiesen: Der von ihr bildlich zum Ausdruck gebrachten Trennung zwischen den Menschen und den anderen Tieren entspricht auch eine grundlegende Erfahrungsskepsis, die unser Selbstverständnis als moderne Menschen prägt. Daher lässt sich einerseits auch bezweifeln, dass eine Untersuchung des Mensch-Tier-Verhältnisses gültige Ergebnisse produzieren kann, sofern sie mit der vordarwinschen Trennungslogik einer fundamentalen Differenz zwischen Tieren und Menschen eine Grundbedingung als unhinterfragbar voraussetzt, die historisch offenkundig kontingent ist. Andererseits ist die Einsicht in die uns prägende Erfahrungsskepsis auch deswegen wichtig, weil wir tagtäglich Erfahrungen mit anderen Tieren machen (könnten), denen wir nicht selten eine existentielle Bedeutung zuschreiben, dann aber schnell vor dem vermeintlichen Dilemma stehen, dass wir diesen Erfahrungen gleichzeitig zutiefst misstrauen. Und schon gar nicht gelten diese Erfahrungen als wissenschaftsfähig – wer heute über die Erfahrung etwa der Freundschaft mit Tieren sprechen will, dem empfiehlt die traditionelle Wissenschaft womöglich, dies doch besser an anderer Stelle zu tun. Einzig im privaten Rahmen gestehen wir uns diese Erfahrungen zu, und die etablierten Sprecherpositionen unserer Gesellschaft ermutigen ganz in diesem Sinne dazu, Erfahrungen wie diese besser auf anderen Kanälen zu verbreiten: Man solle dann besser ein Bild malen oder ein Gedicht verfassen, um einer Tier-Erfahrung Ausdruck zu verleihen; für wissenschaftliche Belange scheinen sich diese Erfahrungen hingegen immer schon disqualifiziert zu haben.
Für unser Verhältnis zu den anderen Tieren ist diese Strategie der Veruneigentlichung der Erfahrungen höchst bedenklich. Denn auch der wissenschaftliche Blick bedarf zur Erfassung von Subjekten einer dezidiert subjektiven Perspektive! Damit wird nicht zuletzt der Tatsache Rechnung getragen, dass Menschen kein „zuschauerhaftes Verhältnis zur Wirklichkeit“ (Th. W. Adorno) haben, sondern sich zumeist als Teilnehmende und Mitagierende einer gemeinsamen Lebenswelt verstehen, in der immer auch Tiere vorkommen. Damit Tiere auch zukünftig darin vorkommen können, ist es womöglich entscheidend, nicht allein quantifizierbare Daten in die aktuell so gern geführten Nachhaltigkeitsdebatten einzuspeisen, sondern das qualitative Bedeutungswissen von Menschen in ihren Beziehungen zu anderen Lebewesen auch wissenschaftlich zu rehabilitieren. Aus eben diesem Grund changiert dieses Buch beständig zwischen einer Verortung seiner Frage innerhalb der verschiedenen wissenschaftlichen Diskurse einerseits und einer erfahrungsbezogenen, mitunter erzählerischen und essayistischen Form. Diese ungewohnte Herangehensweise soll den fälschlichen Schluss vermeiden, dass wir die ökologischen Gefährdungen dieser Tage nicht nur als den Anlass, sondern als den Grund einer Neubestimmung des Mensch-Tier-Verhältnisses verstehen. Die bloße Feststellung, dass (andere) Tiere bedroht sind, genügt noch nicht, um zu begründen, warum eine solche Neubestimmung notwendig ist. Vielmehr brauchen wir ein Argument, das verdeutlichen kann, was genau mit dieser Bedrohung auf dem Spiel steht. Was also fehlt, wenn (uns) die Tiere fehlen?

Ihr graubraunes Fell war makellos. Ein verheißungsvoller Aprilwind strich darüber und teilte es so, dass das weiße Unterfell sichtbar wurde. Während ich mich zu der Maus auf die moosbewachsene Waldlichtung kniete, musste ich daran denken, dass ein solch perfektes Fell schon bei gesunden Mäusen selten zu finden ist. Meist sind die Tiere, wenn auch nicht überdeutlich, doch erkennbar von ihrer Umwelt und bisweilen von ihrem Alter gezeichnet. Wer nach einem futterlosen Tag bereits dem Hungertod nahe ist, mag andere Sorgen haben als ein glänzendes Fell. Die kleine Maus vor mir jedoch schien äußerlich perfekt .
Читать дальше