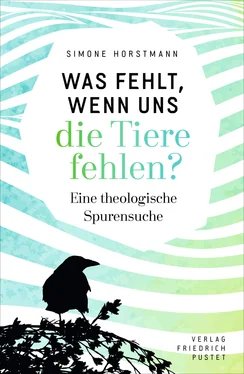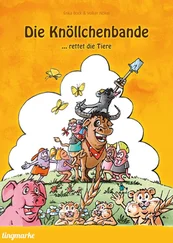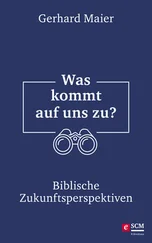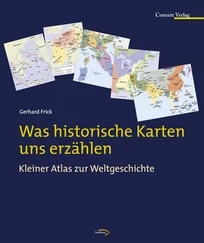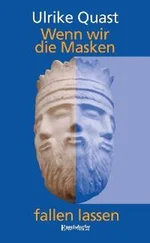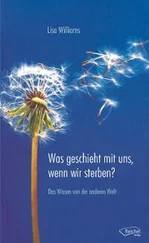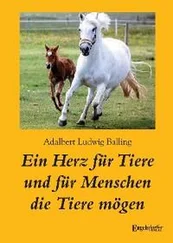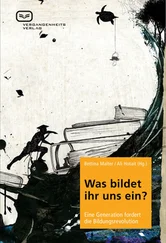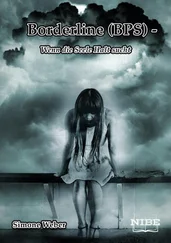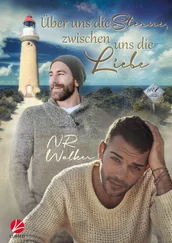Was genau also drückt sich aus in unseren Klagen über das Sterben und Aussterben jener unzähligen Tiere und Tierarten? Seit es die Menschen gibt, haben sie sich stets in einer Umgebung wiedergefunden, die von anderen Tieren bevölkert war. Die Hand, die wir heute über den Kopf eines Hundes gleiten lassen, wiederholt wohl eine der ältesten Erfahrungen des Menschen. Lange bevor es den Menschen als solchen gab, gab es immer schon andere Tierspezies. Seit dem sich in den letzten Jahren ein Bewusstsein dafür durchgesetzt hat, dass mit der ökologischen Katastrophe die Möglichkeit der völligen und unwiederbringlichen Vernichtung vieler tausender Tierarten in greifbare Nähe rückt und vielfach bereits eingetreten ist, fragen viele Menschen danach, wie unser Umgang mit Tieren sein soll. Was bedeutet uns das Aussterben einer Art? Warum schmerzt es uns so sehr, jede Minute einen neuen, unwiederbringlichen Verlust beklagen zu müssen? –
Menschen als „Inter Spezies“-Wesen Menschen als „Inter Spezies“-Wesen Viele neuere Lebensentwürfe und soziale Bewegungen verstehen sich als dringend nötige Antworten auf die Folgen des Anthropozän. Neue Allianzen von Tier und Mensch werden sichtbar. Sie alle fürchten aus gutem Grund das, was noch nie war: die entsetzliche Möglichkeit einer zukünftigen Menschheitsgeschichte ohne die anderen Tiere. Wir dürfen wohl annehmen, dass die Tiere dem Menschen nicht nur ein Apriori, die Bedingung aller Erfahrung, sondern zugleich die prima experientia , die erste und vielleicht fundamentalste Erfahrung waren. So betrachtet gab es den Menschen immer nur als Interspezies-Wesen: Er existierte und existiert bis heute nur als Wesen „inter-spezies“, also „zwischen den (anderen) Spezies“, ganz so, wie Darwins Skizze es erahnen lässt: umgeben und in der erlebten Nähe zu anderen lebendigen Tieren. Damit ist nicht der Versuch gemeint, ein weiteres Mal ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen formulieren zu wollen. Vielmehr geht es um die Erfahrung, dass etwas in den (anderen) Tieren in uns älteste Resonanzen auslöst und uns an eine urtümliche Nähe erinnert. Lange bevor die Rede von den Interspezies-Beziehungen zu einer normativen Forderung der neueren ökologischen Ethiken im Angesicht des drohenden Verschwindens unzähliger Arten und Individuen wurde, war sie eine angemessene Umschreibung für das menschliche Dasein zwischen den anderen Lebewesen. Dieses Buch ist daher auch eine Spurensuche: Es fragt in sechs unabhängig voneinander lesbaren Essays nach den vielfältigen Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren, nach der Dimension, der Wirklichkeit und Fassbarkeit des „Inter“ der Interspezies-Beziehungen.
–
Die Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe Die Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe Aus dieser Perspektive heraus fällt zugleich auf, dass die heute üblichen Klagen gerade dieses Moment der Verbundenheit außen vor lassen: Zwar kommt heute kaum ein Gärtner ohne den materialgewordenen Entschuldigungsgestus eines „Insektenhotels“ aus – ein letztes, beschauliches (und meist vollkommen fehlkonstruiertes) Refugium für jene Wildtiere, deren Namen wir längst vergessen haben, bildet nicht selten einen Ausdruck für die dem Menschen offenbar eigene Synthese aus Tatendrang und Hilflosigkeit. Und welche Großstädterin weiß heute nicht die „Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe“ zu rezitieren? Heute, so besagt diese omnipräsente Klage, kleben kaum noch tote Insekten an den Windschutzscheiben der Autos, mit denen wir zuvor unseren kilometerweiten Weg zur Arbeit und zurück hinter uns gebracht haben. Diese Klage übersieht einerseits nur allzu oft, dass sie mit dem beklagten Symptom auch zumindest eine Ursache für selbiges andeutet; andererseits liefert sie mit der „Windschutzscheibe“ eine grundehrliche Metapher, die Auskunft über das vorherrschende Verhältnis zwischen uns und den anderen Tieren gibt: Wir stehen ihnen demnach wie von einer gläsernen Scheibe getrennt gegenüber; von Verbundenheit kann hier keine Rede sein, obwohl die Metapher genau dies ja zugleich als einen Mangel beklagt. Wogegen richten sich also Versuche wie diese? Was genau fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? Die „Litanei von der insektenfreien Windschutzscheibe“ scheint jedenfalls darauf hinzudeuten, dass dieses Fehlen bereits real und greifbar geworden ist, und uns aber zugleich auch – fatalerweise – jene Mittel abhandengekommen sind, mit denen wir dieses Fehlen angemessen beschreiben können. Aus diesem Grund ist es ein zentrales Anliegen dieses Buches, das „Fehlen“ der Tiere so zur Sprache zu bringen, dass es sich von den vorherrschenden Problembeschreibungen abhebt: Weder geht es hier um eine rein ökologische Betrachtung, die das Aussterben von Arten in das große Kalkül der Ökologie einbeziehen muss und als einen gesamtökologisch fatalen Schwund an Biodiversität deutet; noch geht es um eine letztlich ökonomisch gefärbte Variante dieses ökologischen Paradigmas, die vor einer Krise versiegender tierlicher Rohstoffe warnt. Ziel des Buches ist es vielmehr, die Angst vor einem Verlust der Tiere – als Individuen, als Arten, als den ganz Anderen und den ganz Vertrauten – in ihrer existentiellen Bedeutung zu erfassen.
– Zum Stellenwert von (Tier-)Erfahrungen
Das tote Tier
„Es hat den Tod als Tod weder vor sich noch hinter sich“– „Statt Todeswirrnis – Reinlichkeit und Ordnung“– Eine Reise ins Herz der Finsternis– „Etwas ist wirksam in uns, das uns wie mit Glas umschließt“– Eine säkulare Zwei-Naturen-Lehre– „Warum hatte er auch nichts aus ihrem Schicksal gelernt?“– Die Bedrohung durch den Anderen schlechthin– Der tote Himmel der Menschen– Wenn der natürliche Tod unnatürlich wird– „… die Zuckungen der gefesselten Opfer, die der Fachmann sich zunutze macht“– Die Schuld der Zurückgebliebenen– In das Leben hineinsterben– Fülle des Lebens– Anmerkungen
Das wilde und das kontrollierte Tier
Die Sehnsucht nach der Wildnis– Die Unerträglichkeit der Wildnis– Die Barbarei der Zivilisation– „Was für Lehren werden denn von diesen Kanzeln verkündet?“– Der Mensch als Gott der Tiere– „Haben Sie den unter Kontrolle?“– Biophilie und Nekrophilie: zwei Grundhaltungen– Leben in ständiger Angst– Angst als Ressource?– Das Phobozän der Wildtiere– Begnadete Wildheit– Natur ist niemals gleichgültig– Anmerkungen
Das mechanische und das beseelte Tier
Fluch und Verheißung des Automaten– „Ich schäme mich ordentlich vor dem Finken dort drüben, der mich mit solch schlauen Augen anblinzelt“– Wenn die Welt nur noch aus „dummem Zeug“ besteht– „… nicht mehr als die Fliegen und Ameisen“– „… was sehe ich außer Hüten und Kleidern, unter denen Automaten verborgen sein könnten?“– Verfahren und Methoden statt der „Lesbarkeit der Welt“– Fleisch und Knochen einer überbelichteten Wirklichkeit– Die Hand auf dem Hundekopf– Fünfzehn seelenlose Hunde– Eine Seele haben, oder doch …– … beseelt werden?– „Seelen“ gibt es nur im Plural– Beseelter Automat?– Anmerkungen
Das missverstandene Tier
Voyager– Irdische Außerirdische– Geschichte deines Lebens– „… nahmen sie beide dieselbe physikalische Realität wahr, aber ihre Wahrnehmungen formulierten sie unterschiedlich“– Denken, wie man ist und sein, wie man denkt– Das Tier, das spricht, aber nicht hören will– Begrifflose Wesen?– Linda bereitet Kopfzerbrechen– Ein Bild, das uns gefällt: der Anthropomorphismus– „Wussten Sie schon, dass Kühe trauern?“– Das Wissen des Ichthylogen– Ein Netz auswerfen, das auch uns mit fängt– „… diese ineinander geknäuelten Krämpfe der Ohnmacht“– Fisch werden oder …– … Fledermaus sein?– „… seine Knochen sind Felsen, seine Adern große Flüsse“– Rettung aus dem goldenen Käfig– Wachsames Schlafen– Interanimalität: das Fleisch der Welt– Teilnehmendes Verstehen– Anmerkungen
Читать дальше