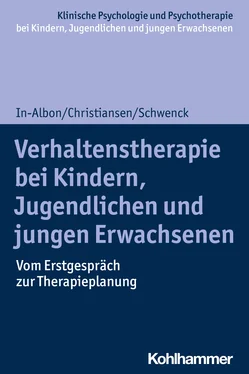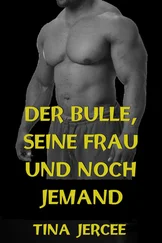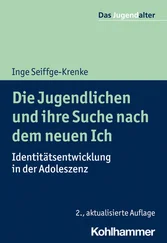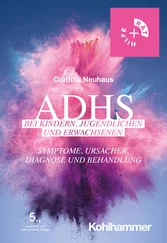• Wiederholung: Zuerst durch kontinuierliche Verstärkung für die Stabilisierung des Lernziels, dann intermittierende Verstärkung für die Löschungsresistenz.
• Reihenfolge: Die Verstärkung muss nach dem erwünschten oder zu erlernenden Verhalten gegeben werden. Zudem sollte diese im Sinne der Kontiguität unmittelbar erfolgen.
• Folgerichtigkeit: Klarer Zusammenhang zwischen Verhalten und Konsequenz, d. h. die Verstärkung muss sofort aufhören, wenn das erwünschte Verhalten zurückgeht oder unerwünschtes Verhalten (wieder) auftritt.
2.3 Sozial-kognitives Lernen
Eine weitere Lernform beschreibt das sozial-kognitive Lernen (Modelllernen, soziales Lernen) nach Bandura (1994), wonach durch das Imitieren des Verhaltens von Anderen gelernt wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Nachahmung wird höher, wenn ein Modell soziale Macht hat, der Beobachterin ähnlich ist oder das Modell die Beobachterin verstärkt. Beim Modelllernen werden die Aneignungs- und Ausführungsphase unterschieden. Bei der Aneignungsphase (Akquisition) spielt zunächst die Aufmerksamkeitszuwendung eine wichtige Rolle. Die Annahme eines Modells als solches kann von bestimmten Eigenschaften (z. B. muss das Modell mit seinem Verhalten Erfolg haben, für die Beobachterin ein attraktives Verhalten zeigen, Prestigeposition des Modells), Charakteristika der Beobachterin (z. B. Beeinflussbarkeit, Selbstsicherheit, Informiertheit, soziale Isolation) und der Beziehung zum Modell abhängen. Die Beobachtung findet meist in Alltagssituationen zufällig oder absichtlich statt. Es ist nicht wichtig, ob das Modell als Person anwesend ist. Modelle können auch Romanfiguren oder Filmfiguren sein. In einem zweiten Schritt der Aneignungsphase spielen Gedächtnisprozesse eine wichtige Rolle, in der die Beobachterin das Verhalten des Modells kognitiv verarbeitet und speichert. In der Ausführungsphase (Performanz) kommt es zu motorischen Reproduktionsprozessen sowie Verstärkungs- und Motivationsprozessen. Bei den motorischen Reproduktionsprozessen ist die Beobachterin in der Lage, die Verhaltensweisen des Modells konkret aufzuführen, d. h. sie übersetzt die gespeicherten Schemata in Verhaltensweisen. Beim Fußballspielen stellen sich Kinder z. B. vor, wie sie einen Angriff aufs Tor vorbereiten. Die Ausführung selbst ist abhängig von der Erwartung, die die Beobachterin an ihr Verhalten knüpft und von der anschließenden Verstärkung.
Die Bobo-Doll-Studie von Bandura
Ein bekanntes Experiment zur Erforschung von Gewalt, ist die Bobo-Doll-Studie von Bandura (1994). In dieser Studie sahen vier- bis fünfjährige Kinder einen Film, in dem ein Hauptakteur »Rocky« sich gegenüber der Plastikpuppe »Bobo Doll« aggressiv verhielt, sie trat, auf sie einschlug und beschimpfte. Der Film hatte jeweils unterschiedliche Enden: Rocky wurde für sein Verhalten entweder belohnt, bestraft oder es wurden keine Konsequenzen gezeigt. Die Kinder ahmten das gezeigte Verhalten Rockys gegenüber der Bobo Doll nach. Hierbei gab es jedoch folgende Unterschiede: Kinder, die die Belohnung und Ermutigung Rockys gesehen hatten, zeigten aggressiveres Verhalten, Mädchen dabei noch mehr als Jungen. Kinder, die den Film mit einer Bestrafung Rockys gesehen hatten, waren deutlich weniger aggressiv. Die Gewaltbereitschaft der Kinder konnte aber durch Aufforderung wieder erhöht werden. Kinder, die den Film mit unkommentiertem Ende gesehen hatten, unterschieden sich kaum von der Gruppe, die das Ende mit Lob und Belohnung gesehen hatte.
Soziales Lernen findet meist in sozialen Kontexten wie Familie, Kindergarten, Schule oder Freundeskreis statt. Aufgrund der Verbindung von kognitiven und sozialen Elementen wird diese Art des Lernens auch als sozial-kognitives Lernen bezeichnet. Bei dieser Form des Lernens spielen Verhaltenskonsequenzen eine wichtige Rolle, wobei diese auch Erwartungen an Situationen oder Handlungen beinhalten. Dabei hat die Einschätzung eigener Kompetenzen sowie der Selbstwirksamkeit einen Einfluss.
Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura (1976, 1979) verknüpft Konditionierungseinflüsse mit Selbstregulationsprozessen. Durch die Ergänzung um kognitive Prozesse wird darauf hingewiesen, dass Lernen nicht rein durch klassisches und operantes Konditionieren sowie Modelllernen erklärt werden kann, sondern dass auch eine persönliche Kontrolle durch Denkvorgänge in Lernprozessen gegeben ist. D. h., es spielen auch motivationale und sonstige selbststeuernde Prozesse eine Rolle, so dass das beobachtbare Verhalten einer Person nicht unverändert übernommen, sondern durch diese aufgeführten Prozesse auf die Person angepasst wird. Die reziproke Kontrolle beschreibt dabei, dass ein Verhalten aufgrund von Verstärkungskontingenzen eine Funktion der Umwelt ist und zugleich die Umwelt durch das Verhalten einer Person beeinflusst wird.
Entsprechende Modifikationstechniken zum Aufbau von sozial kompetentem Verhalten sind beispielsweise strukturierte Rollenspiele, Videoszenen oder auch Selbstinstruktionstechniken. Zusätzlich können Tokensysteme integriert werden, um über Verstärkungskontingenzen Motivationsprozesse günstig zu beeinflussen.
Für die Selbstwirksamkeit bilden Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen zentrale kognitive Vorgänge (Bandura, 1977). Unter Selbstwirksamkeitserwartung wird verstanden, Ziele zu erreichen und Situationen bzw. andere Personen beeinflussen zu können, und somit mit dem eigenen Handeln und Verhalten einen erwünschten Effekt erzielen zu können.
2.4 Lerntheoretische Modelle zur Ätiologie psychischer Störungen
In der Ätiologie für verschiedene psychische Störungen spielen lerntheoretische Annahmen eine wichtige Rolle. Bei der Zwei-Faktoren- Theorie der Angst (Mowrer, 1960) werden klassische und operante Konditionierung miteinander kombiniert. Es handelt sich um ein lerntheoretisches Modell zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängsten. Die Entstehung der Angst wird hierbei durch klassische Konditionierung erklärt. Bei der Aufrechterhaltung spielt die operante Konditionierung eine bedeutende Rolle, insbesondere die negative Verstärkung bzw. das Vermeidungslernen. Der erste Teil der Theorie, also die klassische Konditionierung, wurde vielfach kritisiert und die Theorie wird als nicht ausreichend angesehen, um Phobien zu erklären (Fields, 2006). Bei vielen Menschen gibt es keine Lernerfahrung im Sinne der klassischen Konditionierung, die die Phobie ausgelöst hat (z. B. Hundebiss bei einer Hundephobie). Auch entwickeln nicht alle Menschen, die ein traumatisches Ereignis erleben, eine Phobie und können z. B. nach einem Hundebiss trotzdem weiterhin Hunden ohne Angst begegnen. Laut der Three-Pathways- Theorie von Rachman (1977) kann Angst zusätzlich zur klassischen Konditionierung auch durch Instruktionslernen (Vermittlung verbaler Informationen) und Modelllernen (indirekte Exposition) erworben werden. Ausgehend von der Theorie der klassischen Konditionierung sollte zudem die Angst abnehmen, wenn der unkonditonierte Reiz (Hund) wiederholt ohne traumatisches Ereignis auftritt (Hund geht freundlich auf einen zu, es erfolgt kein Biss). Häufig ist allerdings das Gegenteil zu beobachten, die Angst vor Hunden nimmt trotz der Korrekturerfahrungen weiter zu. Auch das Konzept der Prepardness (Seligman, 1970) ist ein Argument, welches die Kritik an der Zwei-Faktoren-Theorie stützt, da nicht alle Reize die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, als phobische Auslöser zu fungieren.
Das Verstärker-Verlust Modell (Lewinsohn, 1974) als ein Ätiologiemodell für depressive Störungen basiert auf der Lerntheorie der operanten Konditionierung. Wenn aufgrund einer Veränderung von Lebensumständen bisherige positive Verstärker entfallen und keine neuen hinzukommen, kann dies zu depressiven Symptomen führen, im Sinne von Rückzug und Antriebsmangel. Diese Symptome führen dann häufig zu einem weiteren Verstärker-Verlust, ein Teufelskreislauf entsteht. Hierbei kommt es auch auf die Anzahl verfügbarer Verstärker und die Kompensationsmöglichkeiten (Copingstrategien) an.
Читать дальше