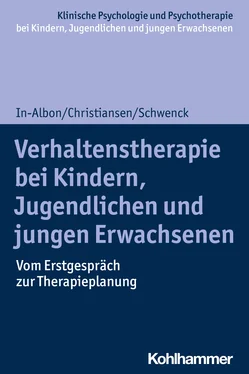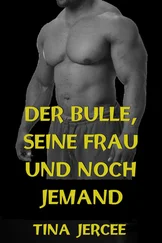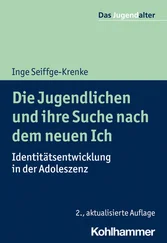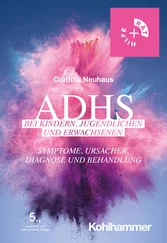• die Fähigkeit zur Empathie,
• die Fähigkeit, interne emotionale Erfahrungen vom externen emotionalen Ausdruck zu differenzieren,
• die Fähigkeit der adaptiven Bewältigung von aversiven Emotionen und belastenden Situationen,
• die Bewusstheit von emotionaler Kommunikation innerhalb von Beziehungen,
• die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit.
Bereits in der frühen Kindheit entwickeln sich wichtige Grundsteine der emotionalen Kompetenzen. In der Verhaltenstherapie ist es für die Arbeit mit Emotionen zunächst wichtig, emotionale Kompetenzen zu erfassen und dann ggf. zu verbessern.
3.4 Soziale Grundfunktionen
Zu den sozialen Grundfunktionen gehört selbstverständlich die Sprache. Wann ist die Sprachentwicklung soweit, dass man mit Kindern ein Gespräch führen kann? Des Weiteren hat der sprachliche Ausdruck auch Konsequenzen für das Verhalten, d. h. Kinder können sich z. B. beklagen, anstelle zu schlagen. Mit dem Grundschulalter haben sich viele Aspekte der Sprache so weit entwickelt, dass eine »normale« Unterhaltung mit den Kindern möglich ist. Im Bereich des Sozialverhaltens können sich bei Kindern mit psychischen Störungen Schwierigkeiten zeigen, z. B. Defizite beim Perspektivenwechsel oder der Rollenübernahme. Daher ist es bei externalisierenden Störungen, aber auch bei internalisierenden Störungen häufig wichtig, soziale Kompetenzen zu trainieren.
3.5 Überprüfung der Lernziele
• Welche entwicklungspsychologischen Faktoren sind in der Verhaltenstherapie relevant?
• Was gehört zu exekutiven Funktionen?
• Definieren Sie Entwicklungsaufgaben.
4 Entwicklungspsychopathologie
Lernziele
• Sie können Risiko- und Schutzfaktoren definieren.
• Sie können die Aufgaben der Entwicklungspsychopathologie benennen.
• Sie wissen was mit differenzieller Suszeptibilität gemeint ist.
Die Entwicklungspsychopathologie setzt sich nach Sroufe und Rutter (1984) mit der Entstehung, den Ursachen und dem Verlauf individueller Muster abweichenden Verhaltens auseinander. Es werden verschiedene Einflüsse (biologische, affektive, kognitive und soziale) der normalen Entwicklung auf die Genese psychopathologischer Symptome sowie der Einfluss psychopathologischer Symptome auf die normale Entwicklung untersucht, d. h. es wird ein biopsychosozialer Ansatz verfolgt. Hervorzuheben ist ebenfalls, dass explizit Ressourcen im Entwicklungsverlauf berücksichtigt werden. Es sind also bei den Einflussfaktoren sowohl die negativen (Risikofaktoren) als auch die positiven Einflüsse (Schutzfaktoren, Kompensationsfaktoren) auf die Entwicklung von Interesse. Zu berücksichtigen sind zudem Interaktionen von Risiko- und Schutzfaktoren.
Die Entwicklungspsychopathologie hat folgende Aufgaben (Petermann & Ulrich, 2019):
• Untersuchung von biologischen, psychischen und sozialen Ursachen von Verhalten
• Vergleich von auffälligen und unauffälligen Entwicklungsverläufen
• Untersuchung von Kontinuität (Stabilität) und Diskontinuität (Veränderung) im Verhalten
• Klärung von Prädiktoren einer zukünftigen Entwicklung
• Untersuchung von Schutz- und Risikofaktoren und ihrer Wirkungsweise
• Untersuchung von Vulnerabilität und Resilienz
Grob kann zwischen belastenden Faktoren (Risikofaktoren, Vulnerabilität) und Ressourcen (Schutz- und Kompensationsfaktoren, Resilienz) von Personen unterschieden werden. Die jeweiligen Begrifflichkeiten werden im Folgenden definiert.
Ein Risikofaktor stellt ein Merkmal, eine besondere Erfahrung oder ein belastendes Ereignis dar, welches die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklungsabweichung erhöht und dadurch eine Störung begünstigt. Es kann zwischen kindbezogenen (internen) und umgebungsbezogenen (externen) Faktoren unterschieden werden. Kindbezogene Risikofaktoren sind z. B. Temperament, biologische Faktoren vor, während und nach der Geburt. Umgebungsbezogene Risikofaktoren beschreiben psychosoziale Stressoren aus dem familiären und sozialen Umfeld des Kindes; einer der bedeutsamsten umgebungsbezogenen Faktoren ist eine elterliche psychische Erkrankung. Es ist jedoch zu beachten, dass es oft ein komplexes Zusammenspiel zwischen den Faktoren gibt. Bei den umgebungsbezogenen Risikofaktoren kann zusätzlich zwischen distalen und proximalen Risikofaktoren unterschieden werden. Distale Risikofaktoren wirken indirekt ungünstig auf die kindliche Entwicklung wie z. B. geringer Bildungsstand, Psychopathologie der Eltern und beengte Wohnverhältnisse. Proximale Risikofaktoren sind beispielsweise Schwierigkeiten der Eltern-Kind-Interaktion und im Erziehungsverhalten. Risikofaktoren wirken nicht universell, sondern stellen ein Risiko im Hinblick auf einen negativen Entwicklungsverlauf dar. Von Bedeutung ist dabei auch, zu welchem Zeitpunkt der Risikofaktor im Entwicklungsverlauf auftritt.
Ausgewählte Risikofaktoren: Temperament und elterliche Psychopathologie
Temperament. Bei Kleinkindern wird häufig zwischen einem schwierigen und einem unauffälligen, einfachen Temperament unterschieden. Kinder mit einem schwierigen Temperament sind meist leicht irritierbar, besitzen eine geringe Selbstregulation und verfügen über eine verminderte willentliche Kontrolle und verhaltensbezogene Hemmung. Ein Kind mit einem einfachen Temperament verfügt über eine gute Selbstkontrolle. Ein schwieriges Temperament kann z. B. einen Risikofaktor für die Entwicklung von ADHS darstellen (Millenet et al., 2013).
Ein bedeutsamer Risikofaktor für die Entwicklung von Angststörungen ist das Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung (Behavioral Inhibition) (Hirshfeld-Becker et al., 2007; Hudson et al., 2011). Kinder mit hoher Verhaltenshemmung reagieren bereits im frühen Kindesalter auf neue Situationen und unbekannte Personen mit Zurückhaltung, Schüchternheit oder Vermeidung (Kagan, 1994).
Elterliche Psychopathologie. Ein allgemeiner Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen ist die elterliche Psychopathologie (McLaughlin et al., 2012). Einen Elternteil mit einer psychischen Störung zu haben, ist daher einer der bedeutendsten Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen: 30-50 % der Kinder psychisch erkrankter Eltern weisen selbst psychische Störungen auf. In der Allgemeinbevölkerung sind es im Vergleich dazu 25 % der Kinder, die bis zum Erwachsenenalter an einer psychischen Störung erkranken (Christiansen et al., 2014). Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die Gene für dieses erhöhte Risiko verantwortlich sind. Es braucht dazu ein Zusammenspiel von Genen und Umweltfaktoren. So begünstigt eine elterliche Angsterkrankung Angsterkrankungen bei den Kindern, wohingegen elterliche depressive Störungen nicht zwangsläufig zu internalisierenden Störungen der Kinder führen, sondern auch externalisierende Störungen begünstigen können (van Santvoort et al., 2015). D. h., dass mit hoher Wahrscheinlichkeit genetische Faktoren eine Rolle spielen, aber auch Umweltfaktoren, wie z. B. Modelllernen.
Als Vulnerabilität wird jene Konstitution bezeichnet, die ein Individuum gegenüber negativen Entwicklungseinflüssen in besonderer Weise empfindlich bzw. anfällig macht, z. B. eine genetische Vulnerabilität oder eine chronische Krankheit. Es kann unterschieden werden zwischen primärer und sekundärer Vulnerabilität. Primäre Vulnerabilität beschreibt eine Anfälligkeit, die das Kind von Geburt an aufweist, während bei der sekundären Vulnerabilität die Anfälligkeit in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt erworben wird.
Vulnerabilitätsfaktoren wirken indirekt, durch eine Interaktion mit auftretenden Risikofaktoren. Ist ein Kind vulnerabel, reichen wenige Risikofaktoren aus, um eine Störung zu begünstigen.
Читать дальше