Unter einem Gefährdungsdeliktversteht man ein Delikt, bei dem es ausreicht, wenn der Täter durch seine Tathandlung das Rechtsgut lediglich gefährdet.
111Es lassen sich zwei Formen von Gefährdungsdelikten unterscheiden: die konkreten und die abstrakten Gefährdungsdelikte. Zwischen diesen beiden Formen stehen noch die sog. „abstrakt-konkreten“ Gefährdungsdelikte, die auch „Eignungsdelikte“ genannt werden, die aber für das juristische Studium weniger bedeutsam sind.
 Definition
Definition
Unter einem konkreten Gefährdungsdeliktversteht man ein Delikt, bei dem der tatbestandliche Erfolg in der konkreten Gefährdung des Tatobjekts liegt. Die aus einer menschlichen Handlung resultierende Gefahr muss dabei konkret vorliegen, ohne dass jedoch eine Verletzung zwingend erforderlich ist.
Bsp.:Zur Kennzeichnung eines konkreten Gefährdungsdeliktes verwendet der Gesetzgeber regelmäßig die Formulierung: „[…] und dadurch [d. h. durch die Tathandlung] Leib oder Leben […] gefährdet“, wie dies z. B. bei der Straßenverkehrsgefährdung, § 315c StGB, der Fall ist. Eine konkrete Gefährdung liegt dabei immer dann vor, wenn das Ausbleiben einer Verletzung nur noch vom Zufall abhängt. Der Eintritt der konkreten Gefahr ist bei diesen Delikten (objektives) Tatbestandsmerkmal mit der Folge, dass die Gefährdung (die jeweils konkret festzustellen ist) vom Vorsatz des Täters umfasst sein muss.
 Definition
Definition
Unter einem abstrakten Gefährdungsdeliktversteht man ein Delikt, bei dem die aus einer menschlichen Handlung resultierende Gefahr lediglich gesetzgeberisches Motiv, jedoch nicht Tatbestandsmerkmal ist.
Bsp.:So soll die schwere Brandstiftung, § 306a Abs. 1 StGB, das Leben von Menschen schützen, welches durch das Inbrandsetzen der genannten Gebäude regelmäßig gefährdet ist. Im Tatbestand hat dieses Motiv des Gesetzgebers jedoch keinen Niederschlag gefunden. Bei den abstrakten Gefährdungsdelikten hat der Gesetzgeber eine bestimmte Verhaltensweise generell als so gefährlich angesehen, dass er auf das Erfordernis des Eintritts einer konkreten Gefahr verzichtet hat. Weder eine mögliche Verletzung noch eine irgendwie geartete Gefährdung sind daher Tatbestandsmerkmale. Allein die gefährliche Tätigkeit als solche ist unter Strafe gestellt. Die abstrakten Gefährdungsdelikte sind daher zumeist auch schlichte Tätigkeitsdelikte. Als weiteres in der Praxis bedeutsames Beispiel ist die Trunkenheit im Verkehr, § 316 StGB, zu nennen. Hier wird bereits das Fahren in fahruntauglichem Zustand unter Strafe gestellt, selbst wenn eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht vorliegt).
 Definition
Definition
Unter einem abstrakt-konkreten Gefährdungsdelikt(oder auch: Eignungsdelikt) versteht man ein Delikt, bei dem die aus einer menschlichen Handlung resultierende Gefahr wenigstens generell geeignet sein muss, bestimmte Verletzungen herbeizuführen. Eine konkrete Gefährdung ist dabei jedoch nicht erforderlich.
Bsp.:Bei der Luftverunreinigung, § 325 StGB, muss die Handlung (Verursachung von Luftveränderungen) wenigstens (abstrakt) geeignet sein „die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen“.
3.Zustands- und Dauerdelikte
112Je nachdem, ob der Täter durch seine Tathandlung ein konkretes Ereignis (z. B. den Tod eines Menschen im Rahmen des § 212 StGB) oder eine länger anhaltende Wirkung erzielt (wie z. B. bei der Freiheitsberaubung, § 239 StGB), unterscheidet man zwischen Zustands- und Dauerdelikten.
 Definition
Definition
Unter einem Zustandsdeliktversteht man ein Delikt, bei dem bereits das bloße Herbeiführen eines bestimmten Zustandes den Unrechtstatbestand verwirklicht.
Bsp.:Bei der Körperverletzung, § 223 StGB, führt allein die Tathandlung der Gesundheitsschädigung zur Verwirklichung des Tatbestands. Der Täter muss diese Gesundheitsschädigung danach nicht noch durch weitere Handlungen aufrechterhalten (obwohl die Gesundheitsschädigung bis zum Zeitpunkt der endgültigen Heilung natürlich andauert, diese aber vom Täter nicht mehr beeinflusst werden kann).
 Definition
Definition
Unter einem Dauerdeliktversteht man ein Delikt, bei dem nicht nur die Herbeiführung eines bestimmten Zustandes, sondern auch dessen Fortdauern den gesetzlichen Unrechtstatbestand verwirklicht.
Bsp.:Der Hausfriedensbruch, § 123 StGB, ist bereits mit dem Betreten des fremden Grundstücks vollendet. Das Delikt „dauert“ aber bis zum Verlassen desselben fort. Oftmals ist eine gewisse Dauer sogar für die Deliktsverwirklichung zwingend erforderlich, wie z. B. bei der Freiheitsberaubung, § 239 StGB, denn hierfür reicht ein lediglich kurzfristiges Festhalten gerade nicht aus.
113Während bei den Dauerdelikten das Delikt mit dem Beginn der tatbestandsmäßigen Handlung regelmäßig vollendet, aber erst mit dem Ende des rechtswidrigen Zustandes beendet ist, 44ist die Tat bei den Zustandsdelikten mit dem Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges zumeist zugleich vollendet und beendet (z. B. bei der Körperverletzung, § 223 StGB). Es gibt aber auch hier Ausnahmen (z. B. beim Diebstahl, § 242 StGB – Vollendung mit der Wegnahme der Sache, Beendigung mit dem Sichern der Beute). Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, dass Dauerdelikte zumeist als schlichte Tätigkeitsdelikte ausgestaltet sind.
4.Begehungs- und Unterlassungsdelikte
114Nach den beiden Grundformen menschlichen Verhaltens (Tun und Unterlassen) unterscheidet man ferner Begehungsdelikte und Unterlassungsdelikte. Im Rahmen der Unterlassungsdelikte kann dann noch zwischen echten und unechten Unterlassungsdelikten unterschieden werden. 45
 Definition
Definition
Unter einem Begehungsdeliktversteht man ein Delikt, bei dem die Tatbestandsverwirklichung an ein aktives Tun anknüpft.
Bsp.:Der Totschlag, § 212 StGB, kann dadurch verwirklicht werden, dass der Täter einen anderen Menschen ersticht, erschießt oder erdrosselt, d. h. ein aktives Tun an den Tag legt. Er muss den Tatbestand hier also gerade durch eine aktive Handlung verwirklichen.
 Definition
Definition
Unter einem Unterlassungsdeliktversteht man ein Delikt, bei dem der Täter den tatbestandsmäßigen Erfolg durch Nichtstun, d. h. durch bloßes Unterlassen erfüllt.
Читать дальше
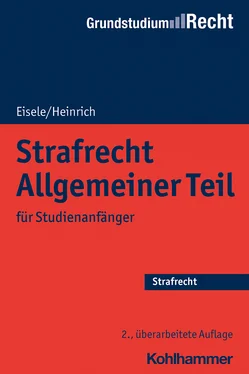
 Definition
Definition










