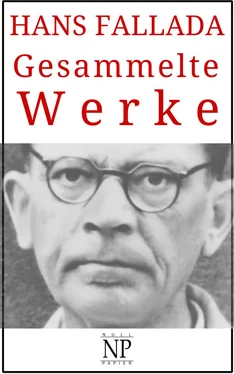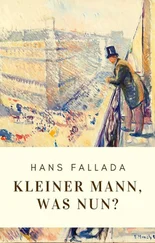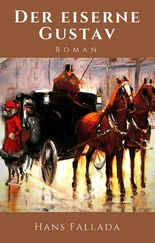Vielleicht war wirklich Not der Schlüssel zu seiner Tat. Wie dem auch sei, ich habe den Mörder Qual gerne gemocht. Es hat mir wehgetan, als sie ihn eines Tages in den Anbau trugen, in die Sterbezelle, in der die meisten von uns ihr Leben beschließen werden. Er starb an der Tuberkulose, der Todesgeißel dieses Totenhauses.
Mein zweiter Schlafgenosse war der Kalfaktor Herbst, mein Nachfolger im Namen, ich habe ihn früher schon kurz erwähnt. Mit ihm schloss ich zuerst im Bau eine Art Freundschaft, die aber bald deswegen in die Brüche ging, weil bei mir nicht das Geringste zu holen war. Herbst, ein junger Bursche von fünfundzwanzig Jahren, der aber schon über fünf Jahre in unserem Bau war und vorher schon eine zweijährige Gefängnisstrafe in einem Jugendgefängnis abgerissen hatte, war eigentlich von Beruf Schlächter und nicht frei von jener unbedenklichen Brutalität, die man manchen Männern dieses Berufes nachsagen zu können glaubt.
Er war ein großer, stämmiger Bursche, mit einem langen, fetten Gesicht, fast toten, starrenden Augen und rotblondem Haar, an dem er jeden Morgen mindestens eine Viertelstunde herum kämmte und bürstete, zum lebhaften, aber aus weiser Vorsicht stumm ertragenen Ärger von uns anderen, denen er dabei in der engen Zelle ewig im Wege stand.
Herbstens Bart aber, ehe er am Sonnabend unter dem »Clipper« fiel, einer Rasiermaschine, die statt der verbotenen Klingen eingeführt war, war brennend rot. Das gab Anlass zu mancher niederträchtigen Anmerkung über den Charakter unseres Essenkalfaktors, Anmerkungen, die leider nur zu viel Berechtigung hatten.
Mit einer schamlosen Unbedenklichkeit ließ sich Herbst von allen Seiten Tabak und Lebensmittel zustecken, Seife, Obst – ohne je an eine Gegenleistung zu denken. Dem, der ihm am Tage vorher eine ganze Handvoll Tabak geschenkt hatte, verweigerte er grob am nächsten Tag ein paar Krümel, auf denen der Rauchhungrige ein bisschen kauen wollte.
Seine Stellung als Kalfaktor gab ihm dieses Übergewicht. Ich lernte bald, mit scharfen Augen zu beobachten, bei wem der Kalfaktor die Essenskelle stärker füllte. In einem Haus, in dem der Hunger ein unbarmherziges Regiment führt, hat der Essenverteiler leicht regieren. An sich war es natürlich verboten, dass der Kalfaktor selbst das Essen ausgab, das gehörte zu den Pflichten der Beamten. Aber die Beamten hatten oft zu viel Rennerei, oder sie waren auch gleichgültig. In diesem Hause hätte ein Engel vom Himmel herabsteigen und das Essen austeilen können, es wäre doch gemurrt worden. So ging alles seinen alten Lauf, und der Kalfaktor Herbst wurde stets fetter dabei.
Die besten Geschäfte machte er aber beim Brotschneiden und -schmieren. Ich habe es schon gesagt, auch dabei sollte ein Beamter anwesend sein, aber Herbst nutzte jede kurze Abwesenheit des Oberwachtmeisters skrupellos aus und stahl Brot, Margarine, Marmelade. Da diese Lebensmittel ihm genau auf den Kopf zugewogen waren, musste er aus unseren Rationen entsprechend kürzen. Aber wenn er jedem Manne unter sechsundfünfzig auch nur zehn Gramm abzog, hatte er schon über ein Pfund Brot verdient, und an einem Pfund Brot kann man sich schon satt essen!
Das so gewonnene Brot fraß der Fette selbst, tauschte es auch, wenn er sehr in Not war, gegen Tabak, in der Hauptsache wanderte es aber zu jenem »Freunde« Kolzer, den ich schon einmal kurz erwähnt habe, als einen der beiden jungen Burschen, die unter uns ältere Männer einen Duft verderbter Liebe trugen. Kolzer war keine »Hure« wie etwa der junge Schmeidler, der sich an jeden verkaufte, er war seinem Freunde Herbst treu. Herbst führte freilich auch ein gestrenges Regiment über ihn, schlug ihn sogar manchmal, sobald er nach Herbstens Ansicht eine Dummheit begangen hatte, fütterte ihn aber auch bis zum Mästen und hielt ein wachsames Auge über ihn.
Kolzer, ein großer, kräftiger Junge mit dunkelblondem Haar, hatte ein nicht unschönes Gesicht, das aber stumpf und ohne Leben wirkte. Er war stark schwachsinnig, konnte weder lesen noch schreiben, hatte aber durch das unermüdliche Bemühen seines Freundes wenigstens »Mensch ärgere dich nicht« spielen gelernt. Aber so unentwickelt Kolzers Geist auch war, so gut verstand es der Junge, sich auf der Station durchzusetzen, und vor allem, sich dauernd von der Arbeit zu drücken. Immer hatte er kleine, nicht schmerzhafte Verletzungen oder geringe Fieberanfälle, die ihm das Arbeiten ganz unmöglich machten.
Unter den Kranken herrschte deswegen eine ständige Missstimmung, bei Schmeidler war es ja ganz ähnlich. »Die jungen starken Bengel sitzen im Bau, und die alten abgemergelten Männer müssen die Arbeit tun!«
Das war wohl wahr, aber Kolzer besaß auch einen mächtigen Fürsprecher in der Person seines Freundes Herbst, der ständig im Glaskasten aus und ein ging und der bevorzugte Nachrichtenträger des Oberpflegers war.
Kolzer also wurde mit Margarine- und Marmeladenschnitten gefüttert, und da man sich im Bau nie isolieren konnte, blieb es nicht aus, dass er von anderen Kranken oft beim Verzehr des Diebesgutes erwischt wurde.
»Heute hat der Kolzer wieder auf dem Klosett Brot gefressen, da war so dick Butter drauf!« (Die Margarine hieß im Haus nur »Butter«.) Dann tobte Herbst über die Lampenmacher.
Zur Rede gestellt vom Oberpfleger, erklärte er, dass er dem Kolzer nur die beim Brotschneiden abgefallenen Krumen gegeben habe, vielleicht sei eine abgebrochene Brotecke dabei gewesen, und die Margarine habe sich Kolzer vom Einwickelpapier abgekratzt … Im Übrigen, wenn es so weitergehe mit den Stänkereien, schmeiße er die Arbeit hin und gehe wieder in die Fabrik. Mochten die anderen doch sehen, ob sie seinen Posten besser versehen könnten. Er sei – hier nahm seine Stimme einen klagenden, weinerlichen Ton an – er sei immer ehrlich und anständig gewesen, aber das dürfe man eben in diesem Haus voller Banditen nicht sein! Nein, jetzt habe er es endgültig über, jetzt gehe er wieder in die Fabrik … Dann redeten ihm die Wachtmeister gut zu, und er blieb gnädig. Er hatte ja auch seine Vorteile: Er hielt auf sich, war sauber und trug unbedenklich den Beamten alles zu.
Zu seinen Gefährten aber war Herbst nach einer solchen Anzeige nicht weinerlich. In seiner Wut über die Denunziation verlor er jede Selbstbeherrschung; schneeweiß im Gesicht schrie er den anderen an und vergaß eine solche Beleidigung seiner »Ehrlichkeit« nie. Vor dem Schlagen nahm er sich höllisch in acht. Früher war er als gefürchteter Schläger öfter in Arrest gewandert, aber der Medizinalrat hatte ihm klargemacht, dass er nie auf eine Entlassung würde rechnen können, wenn er sich nicht zu beherrschen lerne. Und entlassen wollte Herbst unter allen Umständen werden. Die Entlassung war die eine große Hoffnung dieses fünfundzwanzigjährigen Menschen, der die entscheidenden sieben Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht hatte. Für diese Entlassung hatte er das größte Opfer gebracht: Er hatte sich freiwillig entmannen lassen.
Читать дальше