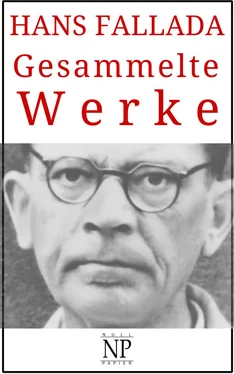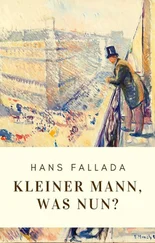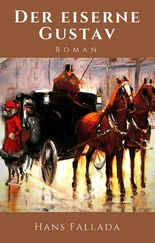»Das ist sie«, antwortet der Wachtmeister. »Und jetzt wollen wir einen Schritt schneller zugehen; es ist gleich Büroschluss, und der Oberinspektor schimpft, wenn ich dann noch mit Ihnen angekleckert komme!«
Von der Straße aus gesehen, macht die Heilanstalt keinen schlechten Eindruck, mein Herz fängt etwas leichter zu schlagen an. Auf einer leichten Anhöhe gelegen, von hohen, alten, reichlaubigen Bäumen umstanden, liegt sie stattlich da wie ein großes Schloss oder eine altertümliche Burg. Große Fenster blinken im Licht der Abendsonne.
Aber als wir näherkommen, sehe ich die hohen roten Mauern darum, oben noch mit Eisen und Stacheldraht bewehrt, ich sehe auch die Gittertraljen 2vor den großen blitzenden Fenstern, und mein Begleiter hat es gar nicht nötig, mir erklärend zu sagen: »Früher war dies einmal ein Zuchthaus.« Nein, das sehe ich auch so, dass dies nicht wie ein Krankenhaus, sondern wie ein Zuchthaus aussieht.
Ein richtiger breiter Wallgraben läuft um den ganzen Komplex, friedlich schwimmen Enten und Gänse auf ihm, aber auf der Brücke, die wir überschreiten, steht ein bewaffneter Posten in grüner Uniform, und das Büro, in das ich geführt werde, ist kein bisschen anders als das Gefängnisbüro, aus dem ich vor anderthalb Stunden entlassen wurde. Sogar die Beamten drin scheinen von genau der gleichen Art zu sein, derselbe gelangweilte, teilnahmslose und doch prüfende Blick, der »die Neuaufnahme« streift, dieselbe langsame Umständlichkeit, mit der dem Transporteur für mich quittiert wird, mit der meine Personalien eingetragen werden.
An diesem Abend gab es nur einen kurzen Lichtblick für mich: Ich war wegen Mordversuchs verhaftet, wegen Totschlagversuchs hatte der alte Amtsgerichtsdirektor meine Überweisung in eine Heilanstalt angeordnet, jetzt wurde ich mit dem Vermerk »wegen Bedrohung« eingeliefert. Ohne dass ich etwas dazu getan hatte, verminderte sich die Last des mir Vorgeworfenen beständig, einen Augenblick sagte ich mir, dass man unmöglich wegen eines so geringen Vergehens mich länger hierhalten, mir mein ganzes Leben zerstören konnte.
Aber dann, als ich wieder hinter einem meiner Führer in grüner Uniform mit einem dicklichen, traurigen Gesicht über all die trostlosen Steinhöfe ging, auf die nur vergitterte Fenster schauten, als ich in einem Riesensteinkasten, durch zwei eiserne Türen gelassen, ein düsteres Treppenhaus hinaufstieg, als ich begriff, dass das erwartete Krankenhaus sich in nichts von einem Gefängnis unterschied, dass es hier wie dort Gitter gab und Wachtmeister und eiserne Disziplin und blinden Gehorsam, da dachte ich nicht mehr an den großen Schritt, den ich vom Mordversuch bis zur Bedrohung gemacht hatte, da glaubte ich nicht mehr an ein geringes Vergehen – da hielt ich alles für möglich, da fühlte ich, wie hilflos ich großen Mächten ohne Gnade ausgeliefert war, Mächten, die kein Herz haben, die kein Mitleid kennen, die nichts Menschliches haben. In eine große Maschine war ich geraten, und nichts bedeutete es mehr, was ich tat oder fühlte, die Maschine lief unabänderlich ihren Lauf, ich mochte weinen oder lachen, das merkte die Maschine gar nicht!
1 Ladung eines Heuwagens <<<
2 (franz.) ›traillage‹: Gitterwerk, Gitterstäbe <<<
Ein Eisengitter und noch ein Eisengitter, und nun treten wir auf einen langen, düstern Gang, der voll steht von fahlen Gestalten. Es stinkt hier, stinkt durchdringend nach Abort, nach Kohl, nach schlechtem Tabak. Hinter dem Gangfenster draußen verglüht das letzte Abendrot. Ich sehe über die hohe, eisenspießige Mauer hinweg in das friedlich-abendliche Land mit Wiesen und schon langsam reifenden Feldern, bis fern am Horizont zum niedrigen Waldstreifen. Um mich stehen schweigend die fahlen Gestalten, lehnen an den Wänden. Ich kann manchmal ein Stück von ihrem Gesicht erkennen, wenn die Glut in ihrer Pfeife aufleuchtet.
Ein Mann, ein untersetzter, kräftiger Mann in weißer Jacke, holt mich in einen Verschlag am Ende des Ganges, sein Heiligtum, »der Glaskasten«, wie dieser Verschlag genannt wird. Von diesem Glaskasten aus kann der Stämmige, der »Herr Oberpfleger« tituliert wird, alles beobachten, was auf dem Gang geschieht, und er beobachtet sehr scharf, wie ich noch erfahren soll. Er sieht sogar Dinge, die er gar nicht sehen kann, er weiß, was in den Zellen geschieht, er kennt alles, was bei der Arbeit passiert – er ist das strenge Gewissen der Station 3, der Nachrichtendienst des Arztes.
»Setzen Sie Ihren Koffer erst einmal hier ab, Sommer«, sagt der Oberpfleger zu mir. »Morgen früh gebe ich Ihnen Anstaltszeug, Zivil ist hier verboten. Und jetzt zeige ich Ihnen Ihr Bett, es ist Schlafenszeit, hier wird um halb acht Uhr abends ins Bett gegangen, morgens um dreiviertel sechs Uhr stehen wir aber auch schon wieder auf …«
»Darf ich vielleicht noch um etwas Abendessen bitten?«, frage ich. »Ich habe dort keines bekommen …« Ich habe erwartet, dass ich ein »Nein« höre, wie damals bei meiner ersten Einlieferung ins Gefängnis. Ich habe eigentlich gar nicht fragen wollen, ich habe es doch nun gelernt: Ein Gefangener darf nichts sagen, nichts fragen, nichts bitten.
Aber – o Wunder – der Oberpfleger nickt mit dem Kopf und sagt: »Das sollen Sie haben, Sommer. Setzen Sie sich solange in den Tagesraum.«
In den Tagesraum werde ich gesetzt, es ist ein langer, dreifenstriger Raum, der nichts enthält wie abgescheuerte, einmal weiß lackiert gewesene Holztische, primitive Holzbänke ohne Lehne und eine Art Küchenuhr an der Wand. Ich setze mich auf eine Bank – die Küchenuhr zeigt kurz nach halb acht Uhr.
Draußen ertönt der Ruf: »Schlafen gehen! Sachen raus!« Ein heftiges Geschlurfe beginnt (wie unglaublich viel Menschen auf dieser einen Station schon zu leben scheinen), Türen schlagen; in einem Nebenraum, in dem wohl die Aborte untergebracht sind, beginnt ununterbrochen Wasser zu rauschen. Halb acht Uhr und ins Bett, wie die Kinder, früher als die Kinder!
Wie werde ich diese Nacht hinbringen? Wie die sechsunddreißig Nächte der Beobachtungszeit? Und vielleicht viele, viele Nächte danach? Die unendliche Länge einer endlosen Zeit, in der nichts geschieht, legt sich wie ein Bleigewicht auf mich. Dieser kahle Raum, in dem nichts als das Allernotwendigste ist, erscheint mir wie ein Abbild meines künftigen Lebens. Nichts mehr zu erwarten, nichts mehr zu wünschen, nichts mehr zu hoffen … Leben und warten, ein Leben, das sich nur auf das Künftige richtet, in dem jede Stunde leer ist, und auch das Künftige wird leer sein …
Читать дальше