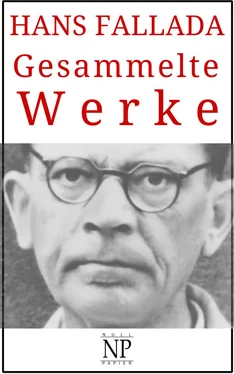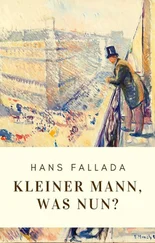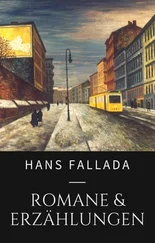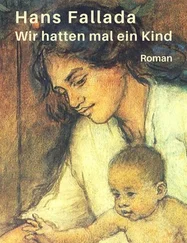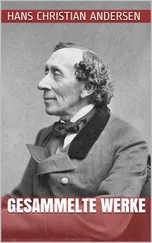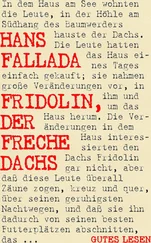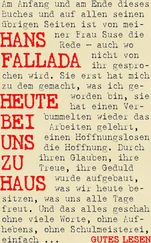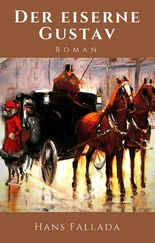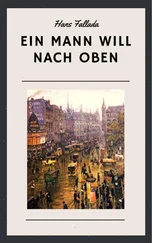»Mein inniggeliebter Führer!
Eine verzweifelte Mutter bittet Dich auf den Knien um das Leben ihrer Tochter. Sie hat sich schwer an Dir vergangen, aber Du bist so groß, Du wirst Deine Gnade an ihr walten lassen. Du wirst ihr verzeihen …«
Hitler, der zum Gott geworden ist, Herr des Weltalls, allmächtig, allgütig, allverzeihend! Zwei alte Menschen – draußen rast der Krieg und mordet Millionen, sie glauben an ihn, noch da er ihre Tochter dem Henker überantwortet, glauben sie an ihn, kein Zweifel schleicht in ihr Herz, eher ist ihre Tochter schlecht als Gott der Führer!
Sie wagen nicht, den Brief im Dorf abzusenden, gemeinsam wandern sie zur Kreisstadt, um ihn dort zur Post zu geben. Als Adresse steht auf ihm: »An die eigene Person unseres innig geliebten Führers …«
Dann kehren sie heim in ihre Stube und warten gläubig, dass ihr Gott gnädig ist …
Er wird gnädig sein!
Die Post nimmt das verlogene Gesuch des Anwalts wie das hilflose von zwei trauernden Eltern und befördert beide, aber sie bringt sie nicht zum Führer. Der Führer will solche Gesuche nicht sehen, sie interessieren ihn nicht. Ihn interessieren Krieg, Zerstörung, Mord, nicht die Abwendung des Mordes. Die Gesuche wandern in die Kanzlei des Führers, sie bekommen eine Nummer, sie werden registriert, und dann wird ein Stempel auf sie gedrückt: An den Herrn Reichsjustizminister weitergeleitet. Zurück nur hierher, falls Verurteilter Parteimitglied ist, was aus dem Gnadengesuch nicht ersichtlich … (Die zweigeteilte Gnade, die Gnade für Parteigenossen und die Gnade für Volksgenossen.)
Auf dem Reichsjustizministerium werden die Gesuche wiederum registriert und beziffert, sie bekommen einen weiteren Stempel: An die Gefängnisverwaltung zur Stellungnahme.
Die Post befördert die Gesuche ein drittes Mal, und ein drittes Mal bekommen sie Nummern und werden in ein Buch eingetragen. Eine Schreiberhand setzt auf das Gesuch für Anna wie für Otto Quangel die wenigen Worte: Die Führung war nach der Hausordnung. Anlass zur Gnadenerteilung liegt hier nicht vor. Zurück an das Reichsjustizministerium.
Wiederum zweigeteilte Gnade: die einen, die sich gegen die Hausordnung vergingen oder die sie nur befolgten, geben keinen Anlass zur Gnade; aber wer sich durch Spionage, Verrat, Misshandlung seiner Leidensgenossen ausgezeichnet hatte, der fand – vielleicht Gnade.
Auf dem Justizministerium buchen sie den Wiedereingang der Gesuche, sie drücken einen Stempel darauf: »Ablehnen!«, und ein munteres Fräulein tippt auf seiner Maschine von morgens bis abends: Ihr Gnadengesuch wird abgelehnt … wird abgelehnt … abgelehnt … abgelehnt … abgelehnt …, den ganzen Tag lang, alle Tage lang.
Und eines Tages eröffnet dem Otto Quangel ein Beamter: »Ihr Gnadengesuch ist abgelehnt.«
Quangel, der kein Gnadengesuch gemacht hat, sagt kein Wort, es ist der Mühe nicht wert.
Aber die Post trägt den alten Leuten die Ablehnung ins Haus, durch das Dorf läuft das Gerücht: »Die Heffkes haben einen Brief vom Reichsjustizminister bekommen.«
Und wenn die alten Leute auch schweigen, beharrlich, angstvoll, zitternd schweigen, ein Bürgermeister hat Wege, die Wahrheit zu erfahren, und bald kommt zu der Trauer die Schande für zwei alte Leute …
Wege der Gnade!
69. Anna Quangels schwerster Entschluss
Anna Quangel hatte es schwerer als ihr Mann: sie war eine Frau. Sie sehnte sich nach Aussprache, Sympathie, ein wenig Zärtlichkeit – und jetzt war sie immer allein, von morgens bis abends mit dem Entwirren und Aufrollen von Bindfäden beschäftigt, die sackweise in ihre Zelle gestellt wurden. So knapp sie ihr Mann auch mit Worten und Taten der Gemeinsamkeit gehalten hatte, dieses Wenig schien ihr jetzt wie ein Paradies, ja, die Anwesenheit nur eines stummen Otto wäre ihr schon ein Segen gewesen.
Sie weinte viel. Der harte, lange Dunkelarrest hatte ihr bisschen Kraft genommen, dieses bisschen durch das Wiedersehen mit Otto wieder aufgeflammte Kraft, das sie in der Hauptverhandlung so stark und mutig gemacht hatte. Sie hatte zu sehr hungern und frieren müssen, sie musste es ja auch jetzt in ihrer kahlen Einzelzelle. Sie konnte nicht wie ihr Mann den schmalen Küchenzettel mit rohen Erbsen aufbessern, sie hatte es nicht gelernt wie er, ihrem Tag eine sinnvolle Einteilung zu geben, einen wechselnden Rhythmus, der immer noch etwas wie Freude erwarten ließ: nach der Arbeit eine Stunde Spaziergang oder die Zufriedenheit über einen frisch gewaschenen Körper.
Auch Anna Quangel hatte es gelernt, nachts aus dem Zellenfenster zu lauschen. Aber sie stand nicht nur manchmal an ihm, sie tat es allnächtlich. Und sie flüsterte, sie sprach am Fenster, sie erzählte ihre Geschichte, sie fragte immer wieder nach Otto, nach Otto Quangel … O Gott, wusste denn wirklich hier niemand, wo Otto war, wie es ihm ging, Otto Quangel, ja doch, ein älterer Werkmeister, aber noch rüstig, sah so und so aus, dreiundfünfzig Jahre – sie mussten es doch wissen!
Sie merkte es nicht, oder sie wollte es nicht merken, dass sie den anderen lästig fiel mit ihren ewigen Fragen, ihrem hemmungslosen Erzählen. Hier hatte jede ihre eigenen Sorgen.
»Halt doch endlich mal deine Klappe, du da, Nummer 76, das wissen wir nun alles, was du quatschst!«
Oder auch: »Ach, das ist die wieder mit ihrem Otto, von hinten und von vorne Otto, was?«
Oder ganz scharf: »Wenn du nicht endlich die Klappe hältst, verpfeifen wir dich! Jetzt wollen auch mal andre drankommen!«
Kroch dann Anna Quangel endlich tief in der Nacht unter ihre Decke, schlief sie noch viel später ein, so fand sie am nächsten Morgen nicht rechtzeitig heraus. Die Aufseherin schalt mit ihr und drohte ihr einen neuen Arrest an. Spät setzte sie sich an die Arbeit, zu spät. Sie musste sich hetzen und machte allen Erfolg ihrer Hetzerei wieder zunichte, weil sie ein Geräusch auf dem Flur gehört zu haben glaubte und nun an der Tür lauschte. Eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang. Sie, die eine ruhige, freundliche, mütterliche Frau gewesen war, veränderte sich durch die Einzelhaft so, dass alle sich an ihr ärgerten. Da die Aufseherinnen stets Mühe mit ihr hatten und unfreundlich mit ihr waren, fing sie Streit mit ihnen an; sie behauptete, ihr gebe man am wenigsten und am schlechtesten zu essen, aber die meiste Arbeit. Schon ein paarmal hatte sie sich bei diesem Wortgefecht so erhitzt, dass sie zu schreien anfing, einfach sinnlos zu schreien.
Dann hielt sie selbst erschrocken inne. Sie bedachte den Weg, den sie gegangen war, bis in diese kahle Todeszelle hinein, sie dachte an ihr Heim in der Jablonskistraße, das sie nie wiedersehen würde, sie erinnerte sich des Sohnes Otto, wie er größer wurde, seines kindlichen Geplauders, der ersten Schulsorgen, der kleinen grauen Hand, die mit ungeschickter Zärtlichkeit ihr ins Gesicht gefasst hatte – ach, diese Kinderhand, die sich in ihrem Leibe, aus ihrem Blut zu Fleisch gebildet hatte, sie war längst wieder zu Erde zerfallen, sie war ihr auf ewig verloren. Sie dachte an die Nächte, da die Trudel bei ihr im Bett gelegen hatte, wenn sie flüsternd, den blühenden jungen Leib nahe dem ihrigen, sich stundenlang unterhalten hatten, über den strengen Vater, der drüben im Bett schlief, über Ottochen und über ihre Zukunftsaussichten. Aber auch die Trudel war verloren.
Читать дальше