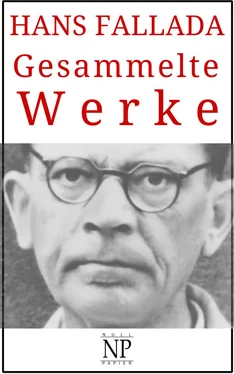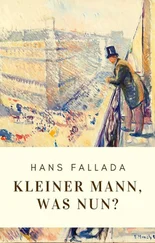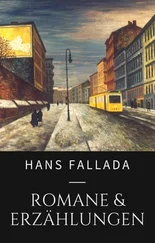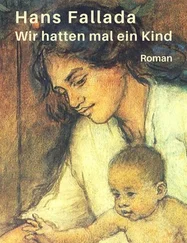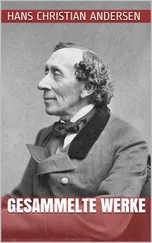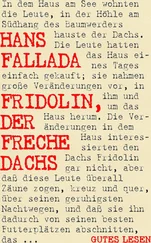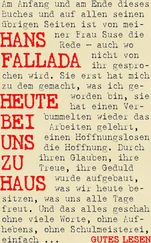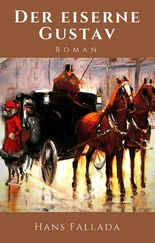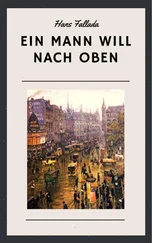Triumphierender Blick des Anklägers Pinscher zu dem versorgten Anwalt.
Und trüber Gegenblick des Anwalts.
»Da es mir vom Hohen Gerichtshof untersagt ist«, begann der Anwalt Anna Quangels von Neuem, »auf den Geisteszustand meiner Mandantin einzugehen, so überspringe ich alle die Punkte, die für eine verminderte Zurechnungsfähigkeit sprechen: ihre Beschimpfung des eigenen Gatten nach dem Tode des Sohnes, ihr seltsames, fast geistesgestört anmutendes Verhalten bei der Frau des Obersturmbannführers …«
Der Pinscher kläfft los: »Ich erhebe schreienden Protest dagegen, wie der Verteidiger der Angeklagten das Verbot des Gerichtes umgeht. Er überspringt die Punkte und hebt sie umso nachdrücklicher hervor. Ich beantrage Gerichtsbeschluss!«
Wiederum zieht sich der Gerichtshof zurück, und bei seinem Wiedererscheinen verkündet der Präsident Feisler bitterböse, dass der Anwalt wegen Übertretung eines Gerichtsbeschlusses zu einer Geldstrafe von fünfhundert Mark verurteilt sei. Für den Fall einer Wiederholung wird der Wortentzug angedroht.
Der graue Anwalt verbeugt sich. Er sieht sorgenvoll aus, als plage ihn der Gedanke, wie er diese fünfhundert Mark zusammenbringen solle. Er beginnt zum dritten Mal seine Rede. Er bemüht sich, die Jugend Anna Quangels zu schildern, die Dienstmädchenjahre, dann die Ehe an der Seite eines Mannes, der ein kalter Fanatiker sei, ein ganzes Frauenleben: »Nur Arbeit, Sorge, Verzicht, Sichfügen in einen harten Mann. Und dieser Mann beginnt plötzlich, Karten hochverräterischen Inhalts zu schreiben. Es ist aus der Verhandlung klar erwiesen, dass es der Mann war, der auf diesen Gedanken kam, nicht die Frau. Alle gegenteiligen Behauptungen meiner Mandantin in der Voruntersuchung sind als fehlgeleiteter Opferwille aufzufassen …«
Der Anwalt ruft: »Was sollte Frau Anna Quangel gegen den verbrecherischen Willen ihres Gatten tun? Was konnte sie tun? Ein Leben voller Dienstbarkeit lag hinter ihr, sie hatte nur Gehorchen gelernt, nie Widerstand geleistet. Sie war ein Geschöpf ihres Mannes, sie war ihm hörig …«
Der Ankläger sitzt mit gespitzten Ohren da.
»Hoher Gerichtshof! Die Tat, nein, die Beihilfe zur Tat durch eine solche Frau kann nicht voll bewertet werden. Wie man einen Hund nicht bestrafen kann, der auf Befehl seines Herrn in einem fremden Revier Hasen fängt, so ist diese Frau nicht voll für ihre Beihilfe verantwortlich zu machen. Sie hat – auch aus diesem Grunde – den Schutz des Paragrafen 51 Absatz 2 hinter sich …«
Der Ankläger unterbricht wieder. Er kläfft los, der Anwalt habe wiederum das Verbot des Gerichtshofes übertreten.
Der Verteidiger widerspricht.
Der Ankläger liest ab, von einem Block: »Nach dem Stenogramm hat die Verteidigung Folgendes gesagt: Sie hat – auch aus diesem Grunde – den Schutz des Paragrafen 51 Absatz 2. Die Worte ›Auch aus diesem Grunde‹ beziehen sich ganz klar auf die von der Verteidigung behauptete Geisteskrankheit der Familie Heffke. Ich beantrage Gerichtsbeschluss!«
Präsident Feisler befragt den Verteidiger, worauf er die Worte »Auch aus diesem Grunde« bezogen habe?
Der Anwalt erklärt, diese Worte hätten sich auf im weiteren Verlauf seiner Verteidigung zu entwickelnde Gründe bezogen.
Der Ankläger schreit, niemand beziehe sich in seiner Rede auf etwas, das noch nicht gesagt worden sei. Eine Bezugnahme könne nur auf Bekanntes, nie auf Unbekanntes erfolgen. Die Worte des Herrn Verteidigers stellten nichts als eine faule Ausrede dar.
Der Verteidiger protestierte gegen den Anwurf, eine faule Ausrede gebraucht zu haben. Im Übrigen könne man sich in einer Rede sehr wohl auf etwas noch Vorzutragendes beziehen, dies sei eine bekannte Redekunst, Spannung auf etwas noch Vorzutragendes zu erzeugen. So habe zum Beispiel Marcus Tullius Cicero in seiner berühmten dritten Philippika gesagt …
Anna Quangel war vergessen; jetzt sah Otto Quangel mit vor Staunen geöffnetem Munde von einem zum anderen.
Ein hitziger Disput war im Gange. Es regnete Zitate in Latein und Altgriechisch.
Schließlich zog sich der Gerichtshof wiederum zurück, und Präsident Feisler verkündete bei seinem Wiedererscheinen zur allgemeinen Überraschung (denn die meisten hatten über dem gelehrten Disput den Anlass dazu völlig vergessen), dass dem Anwalt der Angeklagten wegen nochmaliger Übertretung eines Gerichtsbeschlusses das Wort entzogen sei. Die Offizialverteidigung der Anna Quangel sei dem zufällig anwesenden Assessor Lüdecke übertragen.
Der graue Verteidiger verbeugte sich und verließ den Sitzungssaal, versorgter denn je aussehend.
Der »zufällig anwesende« Assessor Lüdecke erhob sich und sprach. Er hatte noch nicht viel Erfahrung, er hatte auch nicht recht zugehört, er war vom Gerichtshof eingeschüchtert, außerdem war er zurzeit stark verliebt und keines vernünftigen Gedankens fähig. Er sprach drei Minuten, bat um mildernde Umstände (falls der Hohe Gerichtshof nicht anderer Meinung sein sollte, in welchem Falle er bat, seine Bitte als ungesprochen anzusehen) und setzte sich wieder, sehr rot und verlegen aussehend.
Dem Verteidiger Otto Quangels wurde das Wort erteilt.
Er erhob sich, sehr blond und sehr hochmütig. In die Verhandlung hatte er bisher in keinem Fall eingegriffen, er hatte sich nicht eine Notiz gemacht, der Tisch vor ihm war leer. Während der stundenlangen Verhandlung hatte er sich eigentlich nur damit beschäftigt, seine rosigen, sehr gepflegten Fingernägel sanft gegeneinander zu reiben und immer wieder genau zu betrachten.
Jetzt aber sprach er, der Talar war halb geöffnet, eine Hand hatte er in der Hosentasche, die andere machte sparsame Gesten. Dieser Verteidiger konnte seinen Mandanten nicht ausstehen, er fand ihn widerlich, beschränkt, unglaubhaft hässlich und gradezu abstoßend. Und Quangel hatte leider alles getan, diese Abneigung seines Verteidigers noch zu verstärken, indem er trotz des dringenden Abratens Dr. Reichhardts dem Anwalt jede Auskunft verweigert hatte: er brauchte keinen Anwalt.
Jetzt also sprach Rechtsanwalt Dr. Stark. Seine nasale, schleppende Redeweise stand in starkem Gegensatz zu den krassen Worten, die er gebrauchte.
Er sagte: »Selten haben wohl wir alle, die wir hier zur Stunde in diesem Saale versammelt sind, ein solches Bild abgrundtiefer menschlicher Verworfenheit vorgeführt bekommen, wie es hier heute geschehen ist. Landesverrat, Hochverrat, Hurerei, Kuppelei, Abtreibung, Geiz – ja, gibt es denn ein menschliches Verbrechen, das mein Mandant nicht auf sich geladen, an dem er nicht teilgenommen hat? Hoher Gerichtshof, meine Herren, Sie sehen mich außerstande, einen solchen Verbrecher zu verteidigen. In einem solchen Falle lege ich die Robe des Verteidigers ab, ich selbst, der Verteidiger, muss zum Ankläger werden, und mahnend erhebe ich meine Stimme: die Gerechtigkeit nehme in ihrer äußersten Strenge den Lauf. In Abänderung eines bekannten Satzes kann ich nur sagen: Fiat justitia, pereat mundus! 1Keine Milderungsgründe für diesen Verbrecher, der den Namen Mensch nicht verdient!«
Читать дальше