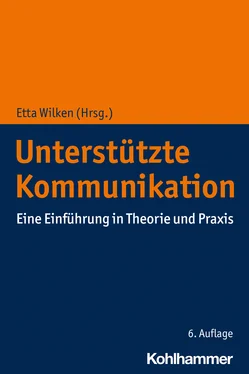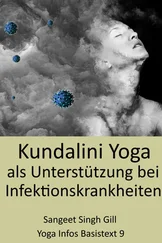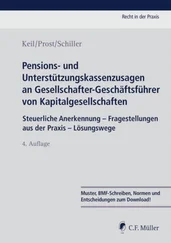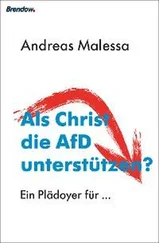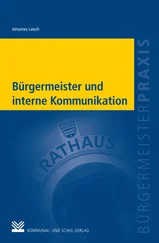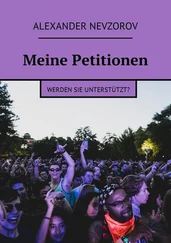Schritt 5: Zusammenfassung der Ergebnisse und Einordnung des Entwicklungsstandes im Meilensteinmodell
In der Zusammenschau ergibt sich aus der quantitativ-normorientierten und der qualitativ-theoriegeleitete Auswertung folgendes Bild: Trotz (autismustypischer) Schwächen in der sozialen Interaktion hat Luis ausreichende basale sozial-kognitive Fähigkeiten aufgebaut, um seinen Bezugspersonen Wünsche und Bedürfnisse mitteilen zu können (intentionale Kommunikation). Er nutzt hierfür ein breites Repertoire an non-verbalen Kommunikationsmitteln, schwerpunktmäßig vorsymbolische Mittel. Luis ist jedoch auch schon in der Lage, spontan symbolische Kommunikationsmittel (repräsentationale Gesten und erste Protowörter) zu verwenden, wenn die Situation dies erfordert. Luis hat ein erstes Sprachverständnis entwickelt und versteht Wörter und einfache Sätze auch außerhalb eines situativen Kontextes (Testsituation). Seine rezeptiven Fähigkeiten sind im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern stark beeinträchtigt, aber deutlich besser entwickelt als seine produktiven kommunikativ-sprachlichen Fähigkeiten. Luis hat massive Probleme in der Lautbildung und verfügt nur über ein sehr kleines Lautinventar, das für die Bildung von Wörtern nicht ausreichend ist.
Schritt 6: Zuordnung der relevanten Entwicklungsaufgaben
Für Luis besteht eine zentrale Entwicklungsaufgabe darin, sein Lautrepertoire zu erweitern. Ferner ist der Ausbau der symbolischen Kommunikationsmöglichkeiten von zentraler Bedeutung, damit der Junge seine massiven verbalen Einschränkungen ausgleichen und sich zunehmend komplexer mitteilen kann. Obwohl diese beiden Entwicklungsaufgaben im Vordergrund stehen sollten, zeigt die Diagnostik außerdem, dass auch die sozialen Kompetenzen bei Luis noch gestärkt und das Sprachverständnis weiter aufgebaut werden sollten.
Ausblick auf die Intervention
Angesichts der massiven Probleme, die Luis in der Lautbildung zeigt, besteht der Verdacht, dass der Junge von einer verbalen Entwicklungsdyspraxie betroffen ist. Da vor diesem Hintergrund nicht mit schnellen Fortschritten zu rechnen ist, verständigen sich die Eltern, die Fachkräfte im Kindergarten und die Autismustherapeutin darauf, mit Luis primär am Ausbau symbolischer Kommunikationsmittel zu arbeiten. Hierfür werden zunächst weitere lautsprachbegleitende Gebärden und ein Kommunikationsbuch mit Symbolkarten eingeführt. Im weiteren Verlauf wird Luis ergänzend mit einer elektronischen Kommunikationshilfe (Talker) versorgt. In der spontanen Kommunikation greift er jedoch weiterhin lieber auf vorsymbolische Mittel und symbolische Gebärden zurück. Den Talker nutzt er vor allem bei Verständnisschwierigkeiten. In der Autismustherapie wird Luis darüber hinaus intensiv im sozialen Spiel und im Ausbau des Sprachverständnisses gefördert. Die Logopädin arbeitet weiter an der Anbahnung von Lauten und Lautverbindungen, unterstützt den Jungen jedoch auch intensiv darin, visuelle Kommunikationsmittel einzusetzen.
Aktas, M. (2004): Sprachentwicklungsdiagnostik bei Kindern mit Down-Syndrom. Entwicklung eines diagnostischen Leitfadens zum theoriegeleiteten Einsatz standardisierter Verfahren. Unveröffentlichte Dissertation. Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft. Universität Bielefeld.
Aktas, M. (Hrsg.) (2012a): Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. München: Elsevier.
Aktas, M. (2012b): Leitfaden für eine theoriegeleitete Diagnostik. In: M. Aktas (Hrsg.): Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. Theorie und Praxis. München: Elsevier, 48–80
Aktas, M. (2012c): Sprachentwicklung: Theoretische Grundlagen. In: M. Aktas (Hrsg.): Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. Theorie und Praxis. München: Elsevier, 7–46.
Aktas, M., Asbrock, D., Doil, H. & Müller, C. (2012): Einleitung: Entwicklungsorientiertes Arbeiten bei Kindern mit geistiger Behinderung – ein Überblick. In: M. Aktas (Hrsg.): Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. München: Elsevier, 3–5.
Bruinsma, Y., Koegel, R. L. & Koegel, L. K. (2004): Joint attention and children with autism: A review of the literature. In: Developmental Disabilities Research Reviews, 10 (3), 169–175.
Buschmann, A. & Jooss, B. (2011). Frühdiagnostik bei Sprachverständnisstörungen. In: Forum Logopädie, 25, 20–27.
Capone, N.C. & McGregor, K.K. (2004): Gesture development: A review for clinical and research practices. In: Journal of Speech, Language and Hearing Research, 47, 173–186.
Doil, H. (2002): Die Sprachentwicklung ist der Schlüssel: frühe Identifikation von Risikokindern im Rahmen kinderärztlicher Vorsorgeuntersuchungen. Unveröffentlichte Dissertation. Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft. Universität Bielefeld. Online verfügbar unter https://pub.uni-bielefeld.de/publication/2302373, abgerufen am 28.07. 2017.
Doil, H. (2012): Entwicklungsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung. In: M. Aktas (Hrsg.): Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung. München: Elsevier, 81–115.
Grimm, H. (2000/2016): Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder (SETK-2). Diagnose rezeptiver und produktiver Sprachverarbeitungsfähigkeiten (2. vollständig überarbeitete und neunormierte Auflage). Unter Mitarbeit von M. Aktas und S. Frevert. Göttingen: Hogrefe.
Grimm, H. (2001/2015): Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3-5). Diagnose von Sprachverarbeitungsfähigkeiten und auditiven Gedächtnisleistungen. (3. vollständig überarbeitete und neunormierte Auflage). Unter Mitarbeit von M. Aktas und S. Frevert. Göttingen: Hogrefe.
Grimm, H. (2012): Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention (3. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
Grimm, H. & Doil, H. (2006): Elternfragebögen zur Früherkennung von Risikokindern. Göttingen: Hogrefe.
Heller, V. & Rohlfing, K. J. (2017): Reference as an interactive achievement: Sequential and longitudinal analyses of labeling interactions in shared book reading and free play. In: Frontiers in psychology, 8, 1–19.
Iverson, J. M. & Goldin-Meadow, S. (2005): Gesture paves the way for language development. In: Psychological Science, 16 (5), 367-371.
Kane, G. (2014): Diagnose der Verständigungsfähigkeit bei nicht sprechenden Kindern. In: E. Wilken (Hrsg.): Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis. (4., überarb. Auf.). Stuttgart: Kohlhammer, 17–35
Karmiloff-Smith, A. (1992): Beyond modularity. A developmental perspective on cognitive science. Cambridge: MIT Press.
Kauschke, C. (2015): Frühe Entwicklung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten. In: S. Sachse (Hrsg.): Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Band Kleinkindphase. München: Elsevier, 3–14
Kauschke, C. & Siegmüller, J. (2010): Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen. (2. Auflage). München: Elsevier.
Liszkowski, U. (2010): Deictic and other gestures in infancy. In: Accion psychologica, 7 (2), 21–33.
Liszkowski, U. (2011): Three Lines in the Emergence of Prelinguistic Communication and Social Cognition. In: Journal of Cognitive Education and Psychology, 10 (1), 32–43.
Meltzoff, A. N. (1988): Infant imitation and memory: Nine-month-olds in immediate and deferred tests. In: Child Development, 59, 217–225.
Müller, C. (2012): Im Fokus: Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und geistiger Behinderung. In: M. Aktas (Hrsg.): Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung: Theorie und Praxis. München: Elsevier, 191–222.
Читать дальше