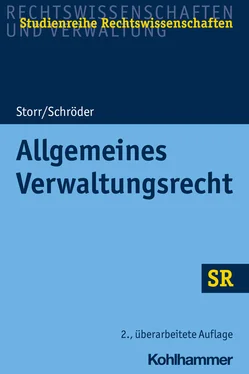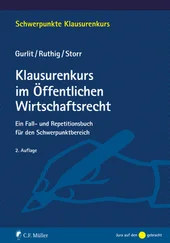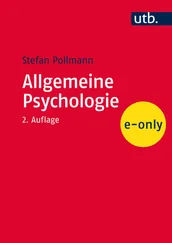II.Bekanntgabe des Verwaltungsakts
III.Konsequenzen der Wirksamkeit des Verwaltungsakts
§ 9 Fehlerhafter Verwaltungsakt
I.Nichtiger VA, § 44 VwVfG
1.Absolute Nichtigkeitsgründe, § 44 Abs. 2 VwVfG
2.Relative Nichtigkeitsgründe, § 44 Abs. 1 VwVfG
3.Nichtigkeit liegt nicht vor in den Fällen des § 44 Abs. 3 VwVfG
II.Rechtswidriger VA, Heilung, Beachtlichkeit
III.Umdeutung fehlerhafter Verwaltungsakte, § 47 VwVfG, Voraussetzungen
§ 10 Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten
I.Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte, § 48 VwVfG
1.Rücknahme rechtswidriger belastender Verwaltungsakte, § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG
2.Rücknahme rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakte
3.Rücknahme unionsrechtswidriger Verwaltungsakte
II.Widerruf rechtmäßiger Verwaltungsakte
1.Nicht begünstigende Verwaltungsakte, § 49 Abs. 1 VwVfG
2.Begünstigende Verwaltungsakte, die eine einmalige oder laufende Geld- oder teilbare Sachleistung gewähren, § 49 Abs. 3 VwVfG
3.Sonstige Verwaltungsakte, § 49 Abs. 2 VwVfG
III.Erstattung, § 49a VwVfG
§ 11 Prüfungsschema Anspruch aus öffentlich-rechtlichem Vertrag
§ 12 Prüfungsschema Planfeststellungsverfahren
I.Formelle Planungsvoraussetzungen
II.Materielle Planungsvoraussetzungen
§ 13 Verwaltungsvollstreckung
I.Prüfungsschema Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen am Beispiel des VwVG
II.Prüfungsschema Vollstreckung in öffentlich-rechtliche Geldforderungen
§ 14 Das Widerspruchsverfahren als Klagevoraussetzung
§ 15 Staatliche Ersatzleistungen
I.Prüfungsschema Amtshaftungsanspruch
II.Prüfungsschema unionsrechtlicher Staatshaftungsanspruch im Besonderen
III.Sekundärrechtsschutz aus Eigentumsbeeinträchtigung
1.Prüfungsschema Entschädigung aus Enteignung
2.Prüfungsschema enteignungsgleicher Eingriff
3.Prüfungsschema enteignender Eingriff
IV.Prüfungsschema Aufopferung
V.Verwaltungsrechtliche Schuldverhältnisse
1.Prüfungsschema Haftung aus verwaltungsrechtlichem Schuldverhältnis
2.Prüfungsschema öffentlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag
3.Prüfungsschema Haftung von Bund und Länder für ordnungsgemäße Verwaltung
VI.Prüfungsschema öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch
VII.Prüfungsschema Folgenbeseitigungsanspruch
Stichwortverzeichnis
A.Grundstrukturen des allgemeinen Verwaltungsrechts
§ 1Verwaltung und Verwaltungsrecht
I.Geschichte der Verwaltung und des Verwaltungsrechts
1.Der Verwaltungsstaat
1Die Verwaltung ist in fast alle Lebensbereiche der Menschen vorgedrungen. Dies deshalb, weil in der modernen, komplexen Welt entsprechender Verwaltungsbedarf besteht: Das Lebensmittelrecht regelt den sicheren Verkehr und Umgang mit Nahrungs- und Genussmitteln, das Recht der Daseinsvorsorge die Zurverfügungstellung und Nutzung öffentlicher Infrastruktureinrichtungen, wie Eisenbahnen, Schwimmbäder, Post etc., das Schul- und Hochschulrecht regelt unsere Rechtsbeziehungen im Bildungsbereich. Neue Regelungsbedarfe führen zu neuen Verwaltungsaufgaben, die neuer Verwaltungsgesetze bedürfen: Das Umweltrecht, das Internetrecht, das Telekommunikationsrecht und das Gentechnikrecht sind Beispiele hierfür. Heute kann mit Fug und Recht gesagt werden, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Verwaltungsstaat ist, 1d. h. ein Staat, der maßgeblich durch die Verwaltung gesteuert wird. Der Verwaltungsstaat versteht sich folglich von den Aufgaben der Verwaltung her. Diese waren – und sind – im Laufe der Zeit einem stetigen Wandel unterworfen, der seinen Grund in der fundamentalen Frage hat, welcher Angelegenheiten sich der Staat annehmen soll.
2.Verwaltung im absolutistischen Staat
2Im absolutistischen Staat (17. und 18. Jhr.) hatte der Fürst die Machtstellung der Stände zunehmend beschränkt, das Ständerecht des Adels zurückgedrängt und wurde selbst der alleinige und unbeschränkte Herrscher („princeps legibus solutus“; „the King can do no wrong“). Dem Landesherrn war es möglich, sich über das Votum der Stände und ihre Rechte hinwegzusetzen (ius eminens = übergeordnetes Recht). Im „Policey“-Verständnis des Absolutismus 2war die umfassende Fürsorge der Bevölkerung Aufgabe des Fürsten, und damit des Staates und seiner Behörden (Beamtenapparat neuartiger Prägung). „Policey“, das umfasste damals die gesamte innere Verwaltung mit Ausnahme von Militär und Finanzen, das ius politiae demnach die umfassende Polizeigewalt. Dieses weite Verständnis staatlicher Aufgaben wurde damit gerechtfertigt, dass das Wohl des Staates und das der von ihm beherrschten Untertanen identisch sei: Was den Staat stärke, komme den Untertanen zugute. Aufgabe des Staates war es daher, die „gemeinschaftliche Glückseligkeit“ 3zu fördern. Dies ist aber nicht im Sinne einer Sozialpolitik nach heutigem Verständnis aufzufassen, weil das ius eminens nicht mit einem (verfassungsrechtlichen) Handlungsauftrag an den absolutistischen Fürsten verbunden war, sondern diesem die alleinige Herrschaft ermöglichen sollte. Erfasst waren nahezu alle Lebensbereiche; das schloss das Bettel- und Armenwesen, die Vermehrung der Bevölkerung, Luxus- und Religionspolizei sowie die Sittenpolizei (etwa Kleiderordnungen) ein, was eine willkürliche und umfassende Bevormundung der Untertanen zuließ. Selbst eine äußere – naturrechtliche – Grenze für das, was Polizei ist und was man berechtigt sei, dafür zu tun und zu fordern, war kaum zu erkennen. Otto Mayer hatte festgestellt: „Das ius politiae ist schließlich eine Art Generalklausel für alles mögliche.“ 4
Ein Verwaltungsrecht als eigenes Rechtsgebiet gab es nicht. Unter Polizeiwissenschaft und Kameralwissenschaft wurde die Verwaltungsführung behandelt. Allenfalls in Lehrbüchern des Staatsrechts konnte man etwas über die Verwaltung erfahren. 5
3 Exkurs Fiskustheorie:In dieser Zeit entstand die Fiskustheorie. Aus der Vorstellung, dass der Fürst als absoluter Herrscher, der über dem Gesetz stehe, sich einerseits selbst nicht rechtswidrig verhalten könne, andererseits aber das Bedürfnis bestand, bei Eingriffen des Fürsten in Rechte der Untertanen (iura quaesita = wohlerworbene Rechte) auf privatrechtlicher Grundlage Ansprüche geltend machen zu können, wurde der „Fiskus“ als eine Rechtspersönlichkeit (Wirtschaftssubjekt) neben dem Staat als Hoheitsträger (Landesherrn und Soldat) entwickelt. Der Fiskus war der als Person fingierte Träger staatlichen Vermögens und geldwerter Rechte, 6der nun auch von Privatleuten vor Gericht verklagt werden konnte. Die Fiskustheorie hat heute ihre Grundlage verloren, sie wirkt aber immer noch in der Vorstellung nach, der privatrechtlich handelnde Staat sei anders zu beurteilen als der hoheitlich handelnde bis hin zur Zuweisung der Amtshaftungsprozesse an die ordentliche Gerichtsbarkeit (Art. 34 S. 3 GG, § 71 Abs. 2 GVG, § 40 Abs. 2 VwGO).
3.Verwaltung im liberalen Rechtsstaat
4Die Ideen von einem liberalen Rechtsstaat – wie sie im 19. Jahrhundert verfochten wurden – standen einem absolutistischen Staatsverständnis diametral entgegen. Das geistige Fundament des liberalen Rechtsstaats reicht bis in die Aufklärung zurück, in der die Stellung des Menschen und seine Beziehung zum Staat neu definiert wurden. So hatte Johann Stephan Pütter bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Beschränkung der Staatstätigkeit gefordert, weil der Bürger nicht „zu seinem Glück gezwungen“ werden dürfe, und Adam Smith 7hatte 1776 in seinem Werk zum Wohlstand der Nationen aus volkswirtschaftlichen Gründen einen freiheitlichen Staat propagiert, doch erst im liberalen Rechtsstaat, wie er sich im 19. Jahrhundert zu entwickeln begann, wird diese Forderung Programm eines neuen Staats- und Verwaltungsverständnisses: Der Staat soll sich aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich zurückziehen und auf die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung konzentrieren; die allgemeine Wohlfahrt soll nicht seine Sache sein. 8Es geht um den Schutz individueller Freiheit vor obrigkeitlicher Bevormundung, Willkür und „Zwangsbeglückung“ 9.
Читать дальше