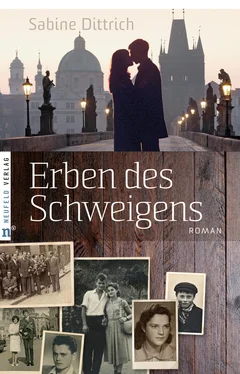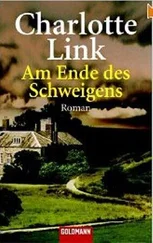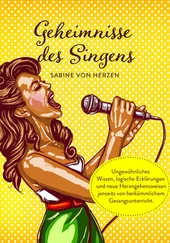In einem anderen Gebäude war ein originalgetreuer Wohnraum für Häftlinge zu besichtigen. Stockbetten. Menschen in dreistöckigen Regalen. Soviel Platz wie in einem Sarg. Die Koffer, die alten Kleider, die Blechbecher. Hatte einer davon Jael Winterstejn gehört? Kann man wirklich so leben? Oder stirbt man unter solchen Umständen nicht schon, bevor man stirbt? Radek drückte mitfühlend meine Hand. Woher wusste dieser Mann, was in mir vorging? Die Mittagssonne brannte unbarmherzig auf meinen Nacken, als wir zuletzt die so genannte Kleine Festung betraten. Diese, so erfuhr ich, galt als ausbruchsicher und diente schon lange vor der Naziherrschaft als Gefängnis. Seit ihrer Fertigstellung warteten in den kleinen dunklen Zellen Menschen auf ihr Schicksal, das manchmal durch Hunger oder Krankheit, oft durch einen Gewaltakt beendet wurde. Was mich schließlich vollkommen den Glauben an das Gute im Menschen verlieren ließ, ist die Tatsache, dass die Kleine Festung in Theresienstadt sofort nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder als Gefängnis benutzt wurde. In den Zellen saßen Deutsche. Die Tschechen – endlich wieder Herren im eigenen Haus – zögerten keine Minute, die Frage der deutschen Minderheit im Land für immer zu lösen. Zu laut hatten manche Sudetendeutsche gejubelt, als Hitler im Herbst 1939 in die souveräne Tschechoslowakische Republik einmarschierte. Ab 1945 folgte der »Odsun«. Das heißt wörtlich übersetzt »Abschub«. Bei uns sagt man »Vertreibung« dazu. Deutsche Juden aus Prag, die Auschwitz überlebt hatten und nach Hause zurückkehrten, fanden sich plötzlich mit weißen Armbinden als Deutsche gekennzeichnet, Seite an Seite mit ihren ehemaligen Peinigern in Theresienstadt wieder – neue Brutalitäten, neues Unrecht, neuer Hass. Diesmal jubelten andere. Und ich ahnte: Dieses Mal hatte es etwas mit mir zu tun.
Wir beendeten unsere Besichtigung und verließen Terežin fast fluchtartig. Nach einigen sprachlosen Kilometern meldete mein Körper Hunger und Durst. Es tat richtig gut, wieder Zeichen des Lebens in sich zu spüren.
»Wir fahren noch nicht nach Prag zurück«, meinte Radek. »Zuerst will ich dir noch Berg Řip zeigen.« Ich konnte in der weiten Ebene voller Mais- und Getreidefelder zuerst nichts entdecken, was die Bezeichnung »Berg« verdient hätte. Radek zeigte nach links und da tauchte er auf. Der Nationalberg aller Tschechen, eigentlich mehr ein zuckerhutförmiger grün bewaldeter Hügel mitten in der Landschaft. »Oben gibt es ein kleines Restaurant«, Radek hatte offensichtlich auch Hunger. Aber zuerst musste ich die Bezeichnung »Hügel« mindestens auf »sehr großer Hügel« berichtigen. Der steingepflasterte steile Weg zum Gipfel brachte mich ganz schön ins Schwitzen. Atemlos oben angekommen, beschloss ich, die Bezeichnung »Berg« doch gelten zu lassen. Vor meinen Augen entrollte sich ein unerwartet weites Panorama.
Genauso ging es dem Stammvater Czech, als er vor vielen Jahrhunderten zur Zeit der Völkerwanderung auf dem Berg Řip ankam. Er blickte auf eine fruchtbare sanfte Ebene und beschloss, sich mit seinem Stamm hier niederzulassen. Das waren sozusagen die Ur-Tschechen. Radek machte es sichtlich Spaß, mich über die tschechische Sagenwelt aufzuklären. Und über die Eigenheiten der tschechischen Sprache. Sie haben jetzt vermutlich »Rip« gelesen, das kleine Häkchen über dem R macht daraus aber einen Buchstaben, den es im Deutschen nicht gibt. Das berühmt-berüchtigte »R-Sch«. Also: Versuchen Sie mal gleichzeitig ein rollendes R und Sch zu sagen. Geht nicht? Na ja, dann nennen Sie den Berg einfach »Schip«. So identifiziert Sie zwar jeder Tscheche als Deutschen, aber er versteht wenigstens, was Sie meinen. Nach einem großen Glas Wasser und vielen Versuchen, die auch unsere Tischnachbarn in Lachen ausbrechen ließen, war Radek mit meiner Aussprache einigermaßen zufrieden.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, besichtigten wir die massige runde Kapelle auf dem Berggipfel. Sie geht auf das elfte Jahrhundert zurück und ist den Heiligen Georg und Prokop geweiht, die angeblich hier gelebt hatten.
Auf einer grasbewachsenen kleinen Lichtung ließen wir uns nieder. Wir lagen nebeneinander und beobachteten schweigend die weißen Wölkchen am blauen Himmel. Eine der Wolken kam direkt auf mich zu. Nein, es war keine Wolke, sondern ein wunderschönes weißes Pferd. Ich schwang mich auf seinen Rücken und dann ritt – nein flog – ich zusammen mit anderen Reitern über das Land. Der große Mann da drüben musste Stammvater Czech sein, denn er gab die Richtung vor. Wohin waren wir unterwegs?
Radek kitzelte meine Nase mit einem Grashalm. »Ich glaube, es ist besser, du wachst auf.« Goldgelbe Lachfünkchen tanzten in seinen braunen Augen.
Die Sonne war hinter einer grauen Wolkenschicht verschwunden, über der Ebene hatte sich ein Gewitter zusammengebraut und schien direkt in unsere Richtung zu treiben. »Ich mag Gewitter!« Radek strahlte begeistert: »Ich auch, also bleiben wir und schauen.« Während die anderen Touristen den Berg hinunter zum Parkplatz eilten, standen wir am Waldrand und beobachteten schweigend die näher kommende Wolkenwand. Der Abstand zwischen Blitz und Donner wurde immer kürzer. Nein, ich hatte keine Angst. Gewitter übten schon immer eine seltsame Faszination auf mich aus. Gefährlich? Die Chance, auf der Autobahn zu sterben, ist viel größer. Aber nur halb so spannend.
Meine Haare flatterten wild durch den Wind, Regentropfen klatschten in mein Gesicht und liefen meinen Hals hinunter. Radek stand dicht neben mir, vorsichtig legte er seinen Arm um meine Schultern und sagte leise etwas auf Tschechisch. Was auch immer das bedeutete, Hauptsache, er nahm seinen Arm nicht wieder weg.
Ich weiß nicht mehr, wie lange wir so standen. Das Gewitter zog über unsere Köpfe hinweg weiter und nahm seinen Zauber mit. Plötzlich fühlte ich mich nur noch nass. Wie kleine Kinder hüpften wir lachend den Berg hinunter zum Parkplatz – und das Beste war: Dort warteten keine Eltern, um uns auszuschimpfen.
Eine Stunde später fand ich mich auf Radeks Wohnzimmersofa wieder. Mein nasses Kleid baumelte an der Wäscheleine im Innenhof. Radek hatte mir T-Shirt und Jeans geliehen, die allerdings viel zu groß waren. Nun tranken wir miteinander Kaffee. In zwei Tagen würde ich abreisen. Hatte ich gefunden, was ich in Prag suchte? Oder hatte ich etwas gefunden, was ich gar nicht gesucht hatte? Radek drückte mir ein Buch in die Hand. »Wenn du Geschichte verstehen willst, musst du das lesen. Es ist sehr gutes Buch. Deutschland und die Tschechen von Ferdinand Seibt. Ich schenke es dir.«
Ein Abschiedsgeschenk? Ich wollte mich nicht von Radek verabschieden. Nicht an diesem Tag und auch nicht zwei Tage später. Was war nur los mit mir? Heute weiß ich es und Sie sagen bestimmt, dass es der berühmte »Blinde mit dem Krückstock« auch schon gemerkt hätte. Damals jedoch konnte oder wollte ich es nicht in mein Bewusstsein lassen und deswegen werde ich es an dieser Stelle meiner Geschichte auch nicht beim Namen nennen. Die Vorsehung trat wieder in Aktion. Diesmal in Form eines Telefonanrufes. »Meine Freunde fahren morgen an einen See. Hast du Lust, mitzukommen? Milena und Tommi verstehen auch gut Deutsch, es wird bestimmt ganz schön.« Radek lag wohl auch etwas daran, den nächsten Tag mit mir zu verbringen. An übermorgen wollte ich noch nicht denken.
Heute war erstmal heute.
Radek hatte das Haus vor einigen Jahren gekauft. Nachdem meine Großeltern 1941 enteignet worden waren, wurde das Haus von der Protektoratsregierung einer deutschen Familie zugewiesen. Diese Menschen wohnten allerdings nur kurze Zeit dort. Im Mai 1945 flüchteten sie vor der herannahenden Roten Armee. Danach ging es in Staatsbesitz über. In der sozialistischen Zeit waren die Mieten vom Staat auf ein sehr niedriges Niveau festgesetzt worden. So konnten Privateigentümer nur selten ihre Häuser modernisieren. Manche Menschen verzichteten sogar zu Gunsten des Staates auf ihr Hauseigentum und wohnten lieber billig als Mieter darin. Damit hatten sie weniger Ärger. Jetzt verstand ich endlich auch den Zustand so mancher Häuser in Tschechien.
Читать дальше