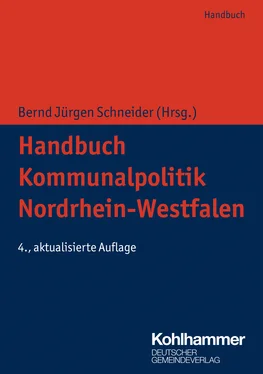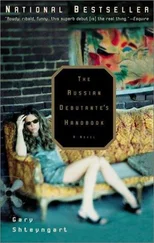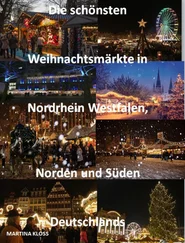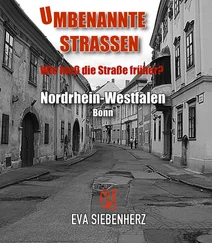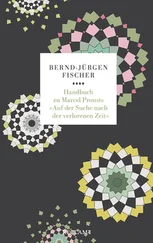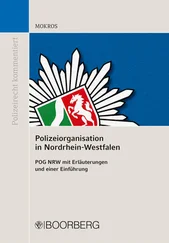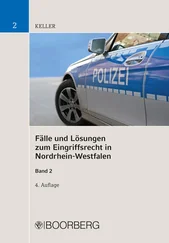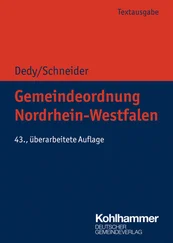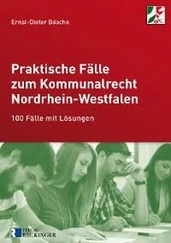IX.Maßnahmen gegen falsche oder diskreditierende Berichterstattung
Selbst wenn man ein gutes Verhältnis zu den Medien aufgebaut hat und fairer, partnerschaftlicher Umgang die Regel ist, kann es in der Berichterstattung zu Verzerrungen, Übertreibungen oder Fehlern kommen. Diese mögen aus Nachlässigkeit (Zeitdruck), Unwissen (Berufsanfängerinnen bzw. Berufsanfänger) oder aus Böswilligkeit respektive politischem Kalkül entstanden sein. Um die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Verwaltung bei den Bürgerinnen und Bürgern zu schützen, muss die Verwaltung gegen offensichtlich falsche oder diskreditierende Berichterstattung vorgehen.
Die schwierigste Aufgabe liegt darin, unter dutzenden Medienäußerungen die wenigen Regelverstöße herauszufiltern, insbesondere in der Text- und Bilderflut der sozialen Netzwerke. Dies erfordert Fingerspitzengefühl und Augenmaß aufseiten der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters oder der Personen, die mit den Medien kommunizieren. Denn das Geschäft der Medien ist naturgemäß die Vereinfachung, Zuspitzung und exemplarische Darstellung von Sachverhalten. Sonst wären sie einer breiten Öffentlichkeit nicht verständlich. Vieles, was aus Sicht der Expertinnen bzw. Experten als Sinn entstellende und fehlerhafte Verkürzung erscheint, entspricht in Wahrheit ganz normalem journalistischem Handwerk.
Gute Redaktionen achten darauf, dass diese handwerklichen Regeln – Fakten richtig wiedergeben, Trennung zwischen Nachricht und Kommentar, alle Gruppierungen zu Wort kommen lassen – eingehalten werden. Allerdings führt der Produktionsdruck in Zeitungen, Rundfunksendern und Online-Medien – besonders im ländlichen Raum – dazu, dass diese Regeln manchmal vernachlässigt werden.
Ist einmal etwas Falsches oder Herabwürdigendes über die Verwaltung und ihr Personal veröffentlicht worden, gibt es drei Schritte, dagegen vorzugehen:
– die Falschbehauptung richtigstellen, um der Desinformation der Bürgerinnen und Bürger entgegenzuwirken
– verhindern, dass diese Falschbehauptung weiterhin verbreitet wird
– die Ursachen für das Entstehen von Falschbehauptungen aufspüren und beseitigen
Nicht immer muss die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister als Repräsentant/in der Verwaltung rechtliche Schritte gegen einzelne Medien oder deren Journalistinnen bzw. Journalisten einleiten. Auf der Richtigstellung falscher Information sollte die Verwaltung auf jeden Fall bestehen – allein im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die wissen wollen, was Fakt ist in ihrer Kommune. Das kann auch ohne Gesichtsverlust der Medien geschehen – etwa in Form einer kleinen Meldung „….in dem Bericht in der gestrigen Ausgabe/in dem gestern gesendeten Beitrag über xxx hat sich ein Fehler eingeschlichen. Richtig muss es heißen yyyy“. Dabei kann verschwiegen werden, wer letztlich den Fehler verursacht hat.
Hält sich der Imageschaden der Kommune durch eine solche Falschinformation in Grenzen, ist eine Wiedergutmachung im rechtlichen Sinne nicht nötig. Meist reicht ein Gespräch mit der Journalistin oder dem Journalisten respektive mit der Redaktionsleitung. Man erläutert, wo der Fehler entstanden ist, und bittet um größere Sorgfalt bei künftiger Berichterstattung. Ist das Verhältnis zu den Medien gut, werden deren Verantwortliche dies beherzigen.
Oft ergibt sich für die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister oder die übrigen in der Medienkommunikation Tätigen die Gelegenheit zu einer Art Kuhhandel – in dem Sinne „jetzt haben wir etwas gut bei Euch“. Dann kann man die Journalistinnen und Journalisten dazu bewegen, einen Bericht, der die Kommune in positivem Licht erscheinen lässt, größer zu ziehen oder überhaupt sperrige Themen aufzugreifen sowie Berichttermine wahrzunehmen, aus denen aller Wahrscheinlichkeit nach eine positive Berichterstattung für die Kommune hervorgeht. Auf diese Weise wird ein Ausgleich hergestellt, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfährt.
Diese Methode hat den Vorteil, dass dabei oft Schwachstellen in der eigenen Kommunikation aufgedeckt werden: Haben wir ausreichend informiert? Haben wir verständlich erklärt? Haben wir zuviel Vorkenntnisse oder Spezialwissen vorausgesetzt? Obwohl Lokaljournalistinnen und -journalisten meist über profunde Orts- und Sachkenntnis verfügen, kann dennoch hier und dort ein Informationsdefizit entstehen.
Wenn eine gütliche Einigung nicht möglich und der Imageschaden beträchtlich ist, sollte man rechtliche Maßnahmen ergreifen. Die wichtigsten sind:
Bei der Gegendarstellung geht es nicht darum, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu übermitteln, sondern eine – aus Sicht des Betroffenen falsche – Tatsachenbehauptung durch eine – aus Sicht der Betroffenen richtige – Tatsachenbehauptung zu korrigieren. Die Gegendarstellung muss bestimmten formalen Ansprüchen genügen. Sie muss dem Verlag, der die falsche Tatsachenbehauptung gedruckt oder gesendet hat, unverzüglich in Schriftform und unterschrieben zugeleitet werden – mit der Aufforderung, diese innerhalb von zwei Tagen zu veröffentlichen. Eine Gegendarstellung darf nicht länger sein als der beanstandete Beitrag. Folgt das Medienunternehmen der Aufforderung nicht, muss der Anspruch auf Gegendarstellung vor Gericht durchgesetzt werden. Einer Gegendarstellung zugänglich sind auch Kommentare – also subjektive Meinungsäußerungen –, wenn darin Fakten postuliert werden, die aus Sicht des Betroffenen nicht der Wahrheit entsprechen.
Die Unterlassungserklärung hat zum Ziel, dass eine aus Sicht des Betroffenen unzutreffende Tatsachenbehauptung oder herabwürdigende Kritik („Schmähkritik“) nicht wiederholt wird. Dazu ist zunächst das Medienunternehmen, welches die Falschmeldung verbreitet hat, abzumahnen – sprich: zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung aufzufordern. Verpflichtet sich das Unternehmen aber nicht von sich aus, die erneute Verbreitung der beanstandeten Meldung zu unterlassen, muss die Kommune vor Gericht eine einstweilige Verfügung beantragen. Dafür kommt jedes Gericht im Verbreitungsgebiet des betreffenden Medienunternehmens infrage.
Ist der Kommune durch unrichtige Tatsachenbehauptungen ein Schaden entstanden, kann sie das verantwortliche Medienunternehmen – soweit dort die publizistische Sorgfaltspflicht verletzt wurde – auf Schadensersatz verklagen. Dies ist etwa denkbar, wenn Investoren sich in einer sensiblen Phase von Verhandlungen mit der Kommune zurückziehen, weil über die Verwaltung oder ihre Führungskräfte kritisch berichtet worden ist („…Finanzierung wacklig …“, „… Bereicherung einzelner …“, „… Prestigeprojekt ohne Nutzen …“). Einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Berichterstattung und Verhandlungsabbruch nachzuweisen, dürfte in der Praxis jedoch schwerfallen.
Man hüte sich allerdings vor pauschaler, undifferenzierter Medienschelte in der Manier „… die schreiben und senden eh’ nur Schlechtes oder Falsches“. Wenn Fehler vorkommen, müssen diese gezielt angesprochen und bereinigt werden – mit dem genannten Instrumentarium. Ansonsten sollte man davon ausgehen, dass die Medien ihre Arbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut machen und sich dabei Mühe geben.
Auch die örtlichen Medien können kein Interesse daran haben, den Standort ihrer Berichterstattung – die Stadt oder Gemeinde sowie deren Verwaltung – ständig nur schlechtzureden. Denn sie leben von diesem Standort und ihre Existenz hängt davon ab, dass es diesem Standort gut geht.
Verwaltung und Medien sind – trotz aller Interessengegensätze – aufeinander angewiesen. Wer diese Partnerschaft aktiv gestaltet, hat im kommunalen Alltag mehr Erfolg. Perspektivisch muss sich die kommunale Kommunikation aber darauf einstellen, dass die professionellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner abhanden kommen, weil das Netz an Redaktionen sowie Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Fläche immer mehr ausgedünnt wird. Zudem betätigen sich immer mehr Privatpersonen mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlicher Professionalität online als Berichterstatterinnen oder Berichterstatter. Die Grenze zwischen hauptberuflich journalistisch Tätigen und „Gelegenheits-Journalistinnen und -journalisten“ verschwimmt immer mehr.
Читать дальше