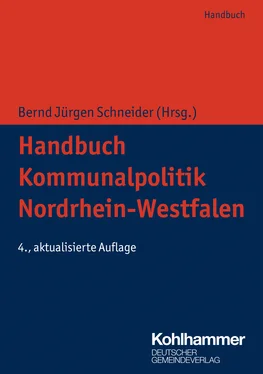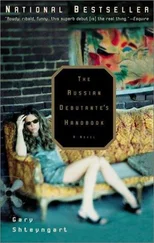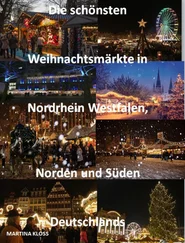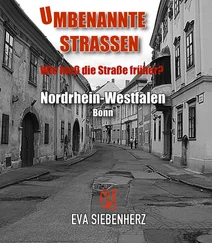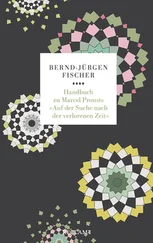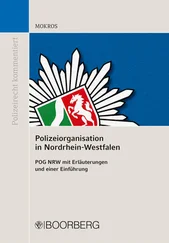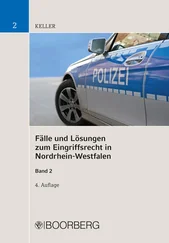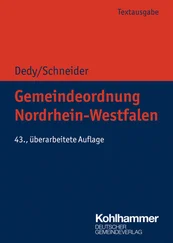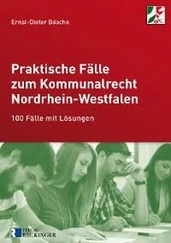VII.Kommunikation im Krisenfall
Eine Krise – sprich: Katastrophe oder Großschadensereignis auf dem Gemeindegebiet – erfordert besondere Maßnahmen. Innerhalb weniger Stunden, oft nachts oder an Wochenenden, müssen die Medien-Aktivitäten erheblich ausgeweitet werden. Entsprechend ist ein Kommunikationszentrum aufzubauen, das räumlich und organisatorisch eng mit dem Lagezentrum zur Bewältigung der Krise verzahnt ist.
Ein schwerer Verkehrsunfall im Innenstadtbereich, eine Explosion auf einem Werksgelände, Hochwasser, ein spektakuläres Verbrechen oder ein Terroranschlag – all dies zieht die Medien an wie ein Magnet. Rasch findet sich ein Dutzend TV-Teams ein, die sich – sofern die Krise mehrere Tage andauert – auch gleich häuslich einrichten wollen.
Für diese Eventualitäten ist es sinnvoll, eine Art Notfallplan zu entwerfen in dem Sinne „Wer benachrichtigt wen – wo trifft man sich zur Erstinformation – wer kann bei der Betreuung der Medien zusätzlich helfen“. Auch empfiehlt es sich, gemeinsam mit dem örtlichen Katastrophenschutz vorab entsprechende Räume (Turnhallen, Versammlungshäuser etc.) auszuwählen, wo im Ernstfall ein Medienbriefing stattfinden kann und wo die Vertreterinnen und Vertreter der Medien arbeiten können (Tische, Stromanschluss, Telefon, Internetzugang, Toiletten). Für den Fall, dass – wie in der Coronakrise – der persönliche Kontakt mit Beschäftigten der Medien vermieden werden soll, sind die Online-Medien entsprechend aufzurüsten. Zudem ist mit den übrigen Behörden der Region, die im Krisenfall zusammenarbeiten müssen, abzusprechen, wer auskunftsberechtigt ist und wer die Kommunikation mit den Medien steuert. Für räumlich ausgedehnte Katastrophen, etwa Hochwasser, empfiehlt sich vorab zu prüfen, ob soziale Netzwerke zur Informationsgewinnung aus dem Katastrophengebiet eingesetzt werden können. Denn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind in der Regel nicht in behördliche Kommunikationsstrukturen eingebunden.
Das Argument „Wir sind eine kleine Gemeinde – auf uns wird doch keiner aufmerksam“ zieht in einer globalisierten Medienwelt nicht mehr. Wenn sich irgendwo eine quotenträchtige Geschichte abspielt, ist den TV-Sendern aus dem In- und Ausland kein Weg zu weit. An Orten, die dafür im Grunde genommen nicht geeignet sind, finden sich in kurzer Zeit hunderte Journalistinnen und Journalisten sowie TV-Technikerinnen und -Techniker ein. Dies könnte sogar zu einer Aufgabe für den kommunalen Ordnungsdienst werden. Zusammenballungen von Menschen müssen entzerrt, Privateigentum von Bürgerinnen und Bürgern muss geschützt werden. Auch hier sollte man möglichst vor dem Ernstfall im Interesse einer reibungslosen Berichterstattung mit den Verantwortlichen Kontakt aufnehmen und klären, wie viele Personen für eine solche begleitende – sprich: ordnende – Medienarbeit zur Verfügung stehen.
Ebenso wichtig wie die technischen Voraussetzungen ist die Philosophie der Krisen-PR. Bei jeder Katastrophe stellt sich unweigerlich die Frage nach den Ursachen und dem Verschulden. Auch wenn diese Frage meist nicht sofort beantwortet werden kann, sollte man sie in der internen Recherche und im Gespräch mit den Medien ernst nehmen. Alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt über Auslöser, Ursachen und Randbedingungen eines Unglücks bekannt ist – auch wenn es später widerlegt werden könnte –, sollte mitgeteilt werden, um Spekulationen den Nährboden zu entziehen.
Insgesamt zahlt sich Offenheit in der Informationsweitergabe aus, ebenso wie Verheimlichen, Verharmlosen oder Kleinreden schwer auf die Beteiligten zurückfällt. Die Analyse unzähliger Krisen und Katastrophen hat ergeben, dass nicht tatsächliche oder vermeintliche Fehler eines Unternehmens oder einer Institution bleibenden Imageschaden verursachen, sondern Pannen und Unterlassungen in der Kommunikation.
VIII.Der Beitrag der Person zum Erfolg der Kommunikation
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann nicht alles machen – auch nicht die gesamte externe Kommunikation. Aber sie oder er kann den Takt und die Grundstimmung für Medienkontakte vorgeben. An ihr oder ihm liegt es maßgeblich, ob ein offenes, partnerschaftliches Klima entsteht oder ob die örtlichen Medien die Verwaltung als eine auf Abgrenzung bedachte Institution wahrnehmen.
Sofern man die Regeln für Kommunikation gegenüber den Medien in der Stadt oder Gemeinde neu festgesetzt hat oder überhaupt eine Struktur in diesen Strang der Kommunikation bringt, sollte man dies den örtlichen Medien frühzeitig mitteilen – etwa in Form eines Hintergrundgesprächs. Wurde eine neue Person in der Verwaltung mit der externen Kommunikation betraut, sollte man diese explizit den Medienvertreterinnen und -vertretern vorstellen („Herr/Frau xxx steht Ihnen künftig für alle Fragen über yyy zur Verfügung – Telefonnummer/Durchwahl/Mobiltelefon“).
Ist die externe Kommunikation einmal an einen Beschäftigten delegiert oder zumindest auf mehrere Personen verteilt, sollte sich auch die Verwaltungschefin respektive der Verwaltungschef an diese Arbeitsteilung halten. Wer Medienauskünfte gibt – vor allem zu Beginn dieser Tätigkeit –, muss sich bei den Journalistinnen und Journalisten ein Standing erarbeiten. Das geht nicht, wenn die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister allzu häufig interveniert mit der Begründung „Das ist ein Top-Thema – dazu spreche ich selbst“. Wenn die oder der Kommunikationsverantwortliche nur noch einfachste technische Auskünfte geben darf („Die Schulrenovierung kostet xxx Euro“), verliert sie oder er das Interesse an dieser Aufgabe. Dann wäre eine solche Person überflüssig – und an anderer Stelle in der Verwaltung sinnvoller einzusetzen.
Insofern hat erfolgreiche Kommunikation viel mit Psychologie und Menschenführung zu tun. Als erstes muss die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister eine klare Struktur für die Kommunikation einrichten und dafür die Zustimmung der Führungsebene in der Verwaltung (Beigeordnete, Amtsleitungen, Fachbereichsleitungen) gewinnen. Steht diese Struktur, sollte die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den Beschäftigten das nötige Vertrauen entgegenbringen: dass sie gegenüber den Medien das Richtige zur richtigen Zeit sagen oder gegebenenfalls bestimmte Dinge nicht nach außen tragen. Ein halbjährlicher verwaltungsinterner Rückblick auf die externe Kommunikation und das Medienecho hilft, das Funktionieren der Struktur zu überprüfen, Schwachstellen aufzudecken sowie das Prozedere zu optimieren.
Entsprechend den Anforderungen des Amtes wird die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister am häufigsten die Kommune in der Öffentlichkeit vertreten. Daraus resultiert auch eine hohe Medienpräsenz. Daher sollte man auch die eigene Erscheinung überprüfen. Passt die Kleidung zum Amt? Leichte Korrekturen an Brille oder Frisur können sinnvoll sein. Für ein aktuelles Porträtfoto, das in allen Publikationen sowie Online-Medien erscheint, sollte man sich Zeit nehmen und nicht am Honorar sparen. Außerdem sollte diese visuelle Visitenkarte alle drei bis vier Jahre erneuert werden.
Wer bei sich Unzulänglichkeiten in der Aussprache oder der Vortragsweise wahrnimmt, sollte ein Rhetorik-Training absolvieren. Schließlich wird ein wesentlicher Teil der Botschaft nicht durch die Worte selbst und deren Sinn, sondern durch nonverbale Signale wie Gestik, Mimik oder Aussprache übermittelt.
Freilich sollten der eigene Charakter, die eigenen Besonderheiten nicht einem Phantom „mediengerechte Bürgermeisterin“ oder „mediengerechter Bürgermeister“ geopfert werden. Das eigene Auftreten muss auf jeden Fall authentisch sein und darf nicht einstudiert wirken. Was skurrile Situationen und Posen angeht: Auf keinen Fall muss die Repräsentantin bzw. der Repräsentant der Verwaltung jeden ausgefallenen Wunsch der Medienvertreterinnen und -vertreter erfüllen, um das eigene positive Image zu bewahren.
Читать дальше