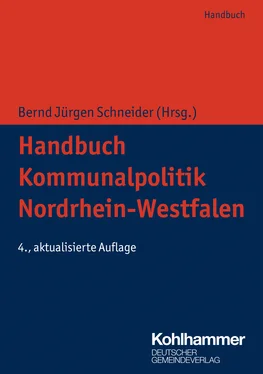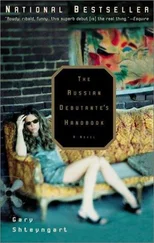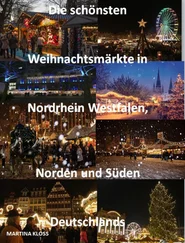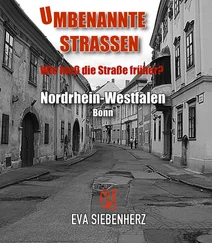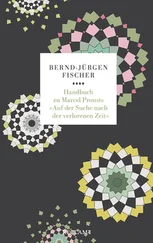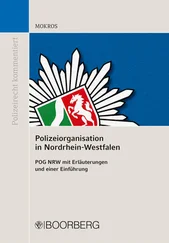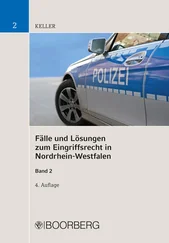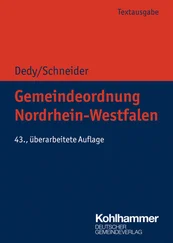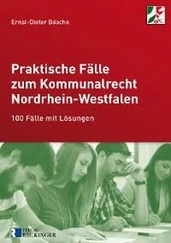Die entscheidende Frage in der externen Kommunikation – bei Kommunen wie bei Unternehmen – ist das „Wer spricht nach außen?“ Hier haben sich in der Praxis vier Grundmodelle herausgebildet, zwischen denen naturgemäß Mischformen möglich sind:
– Das Bürgermeister-Modell
Hierbei äußert sich nur die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gegenüber den Medien.
Vorteil: Die Verwaltung spricht mit einer Stimme, widersprüchliche Aussagen oder Doppel-Statements von unterschiedlichen Stellen der Verwaltung sind damit ausgeschlossen.
Nachteil: Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister muss sich in vielen Detailfragen erst Informationen von den Fachleuten einholen. Dadurch entstehen Doppelarbeit – ein Sachverhalt wird zweimal erzählt – und Übermittlungsfehler („Stille-Post-Effekt“). Daher eignet sich dieses Modell nur für kleine, überschaubare Kommunen mit einer Miniverwaltung.
– Das Beigeordneten-Modell
Hierbei geben neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister auch die Beigeordneten, Amts- oder Fachbereichsleitungen Auskünfte an die Medien.
Vorteil: In dem Zielkonflikt zwischen einheitlicher Außendarstellung und genauer, differenzierter Information wird eine gute Balance hergestellt. Als Führungskräfte erkennen die Beigeordneten, Amts- oder Fachbereichsleitungen bei jeder Medienanfrage neben dem informationellen Kern auch die politische Dimension und können sich entsprechend verhalten. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist von Routineanfragen entlastet und kann sich auf die Top-Themen und Kern-Statements der Kommunikation konzentrieren (Bewertung/Einschätzung/Ausblick).
Nachteil: Mit den Beigeordneten, Amts- oder Fachbereichsleitungen sind Regeln über Art, Häufigkeit und „Grundton“ der Äußerungen gegenüber den Medien zu vereinbaren. Ebenso muss sichergestellt sein, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister umgehend von Äußerungen der Beigeordneten, Amts- oder Fachbereichsleitungen gegenüber den Medien erfährt, um für eventuelle Rückfragen gewappnet zu sein. Bekanntlich haben die Medien großes Interesse daran, unterschiedliche Sichtweisen und Darstellungen innerhalb der Verwaltung zu einem bestimmten (Streit-)Thema aufzudecken. Dies sollte – selbst wenn es diese unterschiedlichen Positionen gibt – in der Außendarstellung unbedingt vermieden werden.
– Das Modell Kommunikationsverantwortliche(r)
Hierbei obliegt es allein der oder dem Kommunikationsverantwortlichen, Informationen an die Medien zu geben oder sich auf Medienanfragen hin zu äußern – in enger Abstimmung mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder auf deren/dessen Anweisung.
Vorteil: Einheitlichkeit in der Außendarstellung wird kombiniert mit professioneller, mediengerechter Aufbereitung des Stoffs. Sämtliche Führungskräfte der Verwaltung sind entlastet von Medienanfragen, die mitunter viel Zeit erfordern.
Nachteil: Die oder der Kommunikationsverantwortliche muss sehr genau informiert werden über sämtliche Sachverhalte und Vorgänge in der Verwaltung, da sie oder er nicht auf eigene Praxiserfahrung zurückgreifen kann. Nichts ist peinlicher für die Außendarstellung der Kommune als eine unwissende Kommunikationsstelle. Zudem entfiele dann der Entlastungseffekt, wenn die Medien notgedrungen bei denen nachfragen, die etwas wissen: Bürgermeisterin oder Bürgermeister sowie Beigeordnete, Amts- oder Fachbereichsleitungen.
Hierbei wird die Kommunikation je nach Themenschwerpunkt auf mehrere Akteure verteilt: Kernverwaltung, Tochtergesellschaften wie Kulturbetrieb, Tourismusmarketing oder Entsorgungswirtschaft sowie externe Agenturen.
Vorteil: Die Kommunikation wird jeweils von denen geleistet, die sich fachlich am besten auskennen und technisch-logistisch am besten ausgestattet sind. Zudem lässt sich in einem Verbund der für die Kommunikation verantwortlichen Stellen die Vertretung im Fall von Krankheit oder Urlaub leichter organisieren. Überlastung im Krisen- oder Katastrophenfall ist ebenfalls leichter abzufangen.
Nachteil: Das Zusammenwirken mehrerer Kommunikationsstellen erfordert genaue Absprachen und ein hohes Maß an Koordination. Auch ist eine einheitliche Außendarstellung in Schreibstil und Gestaltung der Veröffentlichungen schwierig durchzusetzen. Die Beauftragung von Agenturen provoziert unweigerlich Fragen nach dem finanziellen Aufwand.
Bei allen Modellen muss auf jeden Fall die Schnittstelle zwischen den Handelnden der externen Kommunikation klar definiert sein. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister steht dabei in einer zusätzlichen Verantwortung. Sie oder er muss parteipolitische Neutralität wahren. Dies kann vor allem in Wahlkampfzeiten schwierig sein. Was dabei zulässig ist und was nicht, wird in dem Beitrag von Michael Becker „Der Bürgermeister als Beamter“ (S. 61 ff.) näher ausgeführt. Auch sollte man sich davor hüten, Medien, die einem von der politischen Grundausrichtung näherstehen, bevorzugt zu behandeln oder andere, kritisch eingestellte, eher nachrangig zu bedienen. Um der Informationspflicht als öffentliche Verwaltung zu genügen, muss die Kommune sämtliche Medien in gleichem Umfang informieren. Ein Problem liegt heutzutage darin, dass sich im Online-Bereich die Grenzen zwischen professionellen Journalistinnen und Journalisten sowie Privatpersonen, die ihren persönlichen Blog mit kommunalen Nachrichten füllen, immer mehr verwischen. Nicht zuletzt kann man in Zeiten harten Konkurrenzkampfes zwischen den Medien nicht mehr mit „politischem Wohlverhalten“ rechnen, sodass sich die Bevorzugung eines Mediums nicht mehr auszahlt.
Dem Ideal einer einheitlichen Kommunikation seitens der Kommune steht häufig die Realität des politischen Alltags entgegen. Die Kommune teilt sich auf in Bürgermeisterin respektive Bürgermeister, Verwaltung und Rat. Da die Verwaltungschefin bzw. der Verwaltungschef in Nordrhein-Westfalen direkt gewählt ist, können sich Interessengegensätze zwischen dieser/diesem und den politischen Gremien ergeben. Pluralistische Medienarbeit sollte dann in angemessenem Umfang beide Sichtweisen kommunizieren und nicht das Ratsgeschehen ausblenden zugunsten einer einheitlichen Außendarstellung aus der Perspektive der Verwaltung oder des Gemeinde- bzw. Stadtoberhauptes. Sonst entsteht leicht eine Gegenöffentlichkeit, genährt von unzufriedenen Kräften im Rat.
Man sollte nicht übersehen, dass der technische Vorsprung einer Kommunikationsstelle in der Verwaltung gegenüber den „Freizeit-Politikern“ im Zeitalter von Internet, E-Mail und Social Media längst verflogen ist. Jede Bürgerinitiative kann heute höchst wirkungsvoll und professionell Kampagnen aufziehen – ebenso Parteien und Ratsfraktionen. Diese können im Extremfall die externe Kommunikation der Verwaltung konterkarieren oder ganz lahm legen. Das sollte unter allen Umständen vermieden werden. Denn auch Medienarbeit dient letztlich dem Globalauftrag der Kommune, Konsens in der Bürgerschaft zu fördern und Dissens abzubauen.
IV.Aktive und reaktive Kommunikation
Dass aktive, gestaltende Kommunikation besser ist als reaktive, abwartende, leuchtet instinktiv ein. Dennoch hilft es, sich einmal die Gründe vor Augen zu führen. Kommunales Handeln wird von vielen Seiten eingeschränkt: durch Europa-, Bundes- und Landesrecht, durch Geldknappheit und die Auswirkungen der Globalisierung. Dabei entsteht bei Bürgerinnen und Bürgern rasch der Eindruck, Verwaltung und Bürgermeisterin oder Bürgermeister vollzögen nur Entwicklungen nach, die von außen vorgegeben sind. Skepsis und Distanz gegenüber dem kommunalen Geschehen sind die Folge.
Читать дальше